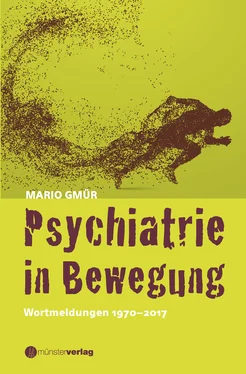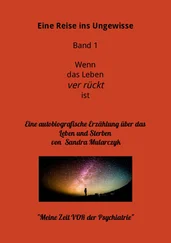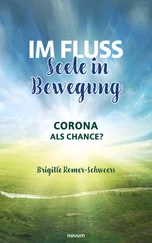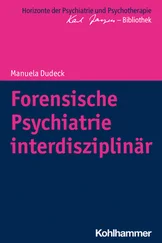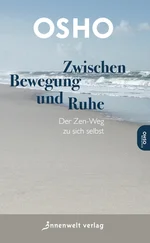Gewiß tun wir meist zu wenig, um mindestens die vermeidbaren Traumatisierungen in dieser vulnerablen Phase zu verhindern. Als Notfallärzte haben wir es uns hier zur ersten Pflicht zu machen, alle unsere Bemühungen in den Dienst der Angst- und Spannungsverminderung zu stellen, weil angesichts der Tiefe der chaotischen Regression und Fragmentierung des Selbsterlebens des Patienten die Anfälligkeit für die Errichtung bleibender Wahngebilde, die ihn neurotisch einengen werden, erheblich ist. Hier ist auch das psychohygienische Postulat angebracht, Aufnahmestationen für Akutkranke eine möglichst sanfte und warme Ausstattung zu geben. Unvermeidliche Traumatisierungen bei brachialen Auseinandersetzungen, Spritzenverabreichungen usw. sind mindestens nach abgeklungener Krise mit dem Patienten ausführlich zu besprechen. Gewiß, auch übersteigerte Gefühle anderer Färbung, etwa der Faszination, können sich in der Wahnstimmung neurotisch einengend verfestigen und sind daher durch entsprechende Umgebungsgestaltung zu lindern. Fast alle Objekte bieten sich als Projektionsträger an für Gefühle von Angst, Wut, Mißtrauen usw. Die milieuhygienischen Maßnahmen sind daher darauf auszurichten, die jeweils vorherrschenden Affekte (psychotischen Ausmaßes) zu mitigieren (Mitigierung der psychotischen Affekte). Bei der nachträglichen gesprächstherapeutischen Bearbeitung der Traumata bewährt es sich, die vom Patienten mitgeteilten Erlebnisse mit geduldiger Aufmerksamkeit anzuhören und außerdem das traumatisierende Umgebungsverhalten motivationsanalytisch realistisch und aufrichtig aufzudecken. Mitteilungen wie die, daß Ärzte und Pflegepersonen mitunter auch mürrische Menschen sind, weil sie strenge und zermürbende Arbeit verrichten, und daß deren beklagte Verhaltensweisen nicht persönlich-boshafter Natur waren, tragen oft dazu bei, daß der Patient seine subjektive Interpretation der Vorgänge zu relativieren vermag. Auch das Zugeben von Fehlern, Entgleisungen, ungeschickten Formulierungen oder andere «Fragwürdigkeiten» können, wenn sie mit Takt und Offenheit dargestellt werden, die Entschärfung eines gespannten Patienten-Psychiatrie-Verhältnisses begünstigen. Beispiel: «Ich gebe zu, ich hätte allenfalls auch eine Hospitalisierung vermeiden können, aber es war kurz vor Ostern, und mir war bei der Hetze im Notfalldienst nicht so wohl dabei, Sie ihrer Familie zu überlassen».
Eine Frage, die allenthalben eine Grundsatzdiskussion auslöst, ist die, ob die Hospitalisierung als eine Kapitulation ambulanter Bemühungen einzustufen ist. Von der allgemeinen Auffassung, daß ein Leben außerhalb des Spitals, wenn immer möglich, der Hospitalisierung vorzuziehen ist und die Klinik nur als subsidiäre Einrichtung zu fungieren hat, gibt es wohl keinen überzeugenden Grund abzuweichen. Die Klinikvermeidung prinzipiell bis an die äußerste Grenze ambulanter Möglichkeiten zu strapazieren, liegt aber wohl kaum im Interesse jedes Patienten. Viel häufiger, als unserem eigenen Helferwillen lieb ist, drückt sich in einer psychotischen Krise ein ungestümer, protestvoller Widerspruch zur Normalität unserer Welt aus, der mit kompromißloser Radikalität und Ausschließlichkeit nach sinnhafter und fulminanter Darstellung und Verwirklichung drängt und im Rückzug in die Klinik mehr Resonanz findet, als wenn er psychopharmakologisch im Ansatz erstickt wird. Der Anspruch des Schizophrenen auf die Krise ist bei solcher eskalativer Entwicklung besser nicht zu verwehren, sondern als organischer Ablauf des psychischen Geschehens auch in seiner Steigerung zum Extremen zu gewähren, von welchem aus sich eine ernüchternde Rückkehr zur Normalität als leichtester Heilsweg anbahnen mag. Der Weg zur Gesundheit führt da manchmal über die Krankheit. Hospitalisierungsgründe gegen den Willen des Patienten müssen hingegen erheblich sein und sind nie durch die Psychose allein gegeben, sondern müssen Selbst- und / oder Fremdgefährlichkeit beinhalten. Viele Schizophrene fühlen sich am ehesten in der Unstete des Lebens geborgen. Sie wandern von einer Stadt zur anderen, schreiben uns Briefe bald von den Bahamas, dann aus dem Orient, aus der ganzen Welt, und verbringen während eines psychotisch durchlebten Jahrzehnts nur wenige Tage in Kliniken oder Untersuchungsgefängnissen. Oder sie verbringen die Jahre als Wandervögel im Dickicht der Stadt. Im Chaos der Welt sind sie gespiegelt und verstanden und halten sich so im Gleichgewicht, jeder Psychotherapie abhold. Weshalb hospitalisieren? Ist aber einmal ein Patient ganz von Sinnen, schlägt im Aggressionssturm wild um sich, poltert an Türen und Wände, so ist es gewiß am besten, die Hospitalisierung ohne Federlesens entschieden zu vollziehen und diese nachträglich mit ihm zu besprechen. An Hospitalisierungen erfährt der Patient oft am deutlichsten sein Scheitern in der Realitätsbewältigung, weil er die Krankheitseinsicht oft nicht durch die Krankheit selbst, sondern nur durch deren Konsequenzen gewinnen kann.
Bei einjähriger krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit erwächst dem Patienten der Anspruch auf eine Rente. Diese ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits gestattet sie dem Arbeitsunfähigen zu überleben, andererseits verschafft sie diesem einen sekundären Krankheitsgewinn und beraubt ihn mindestens teilweise der Motivation, sich zu neuer Erwerbsfähigkeit und Erwerbstätigkeit aufzuraffen. Die Einstellung des berenteten Patienten zu seiner Rente ist oft zwiespältig. Eine gewisse Scham ob der eigenen Schwäche mischt sich mit anklammerndem Interesse aus der Angst, das existenzsichernde Fundament zu verlieren. Beargwöhnen wir die Rentenfreudigkeit des Patienten und stellen seinen Anspruch in Frage, so sehen wir oft unsere Rehabilitationsfortschritte mit einem Mal vertan. Der Patient verliert seine Stelle und sichert sich so von neuem Invalidität und Rentenanspruch. Klüger ist es da, in der Rente einen Förderungsbeitrag zu sehen, die ihm Mut gibt, neue Arbeitsversuche zu wagen. Die Angst, er könnte nach einem gescheiterten Arbeitsversuch für die Dauer eines neuen Jahres den Rentenanspruch einbüßen, ist oft die Wurzel einer hartnäckigen Stagnation in der Resozialisierung; eine Rentenzusicherung für den Fall gescheiterter Arbeitsversuche führt in vielen Fällen zu deren Überwindung. Dies ist ein Beispiel für unsere Haltung gegenüber dem schizophrenen Patienten: Ihm gestatten, schizophren und krank zu sein, damit er möglicherweise gesund werden kann.
1.Conrad, K.: Die beginnende Schizophrenie. 1. Aufl., Thieme, Stuttgart 1958
2.Scharfetter, Chr.: Die Psychopathologie Schizophrener – ein Weg zur Ther Umsch 33 (1976): Heft 7
*SCHARFETTER [2] hat die Basalfunktionen des Ichs mit Vitalität, Aktivität, Konsistenz Demarkation und Identität charakterisiert.
2.Der Schizophrene und wir in der Praxis
Aus:April 1980, Schweizerische Rundschau für Medizin (Praxis) 72, 1983
Das langjährige Bestehen sozialpsychiatrischer Einrichtungen gibt Gelegenheit, über den Umgang mit Schizophrenen zu berichten und einige Überlegungen anzustellen, die sich vornehmlich aus Erfahrungen in der sozialpsychiatrischen Ambulanz herleiten. Gewiss, die Mehrzahl der Schizophrenen wird heute und auch in Zukunft vom Hausarzt und vom niedergelassenen, frei praktizierenden Psychiater behandelt werden. Die besondere Häufung klinikentlassener schizophrener Patienten in einer sozialpsychiatrischen Poliklinik gestattet indessen, Eindrücke von deren Behandlung mit einer besonderen Dichte zu gewinnen, welche die Erweiterung der gängigen klinischen Schizophreniebetrachtungen um einige wesentliche neue Erkenntnisse erlaubt.
Es ist vor allem die Situation des Hausarztes, der seine Patienten oft über Jahre begleitet und ihnen in der Regel jeweils für die Dauer einer Sprechstunde begegnet, welche für die Beobachtung und für das Verständnis des schizophrenen Erscheinungsbildes eine neue Optik bietet (1).
Читать дальше