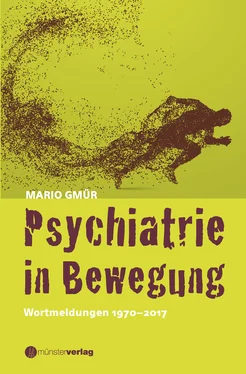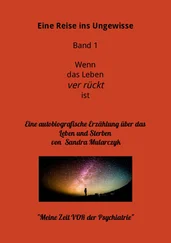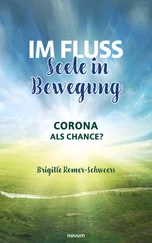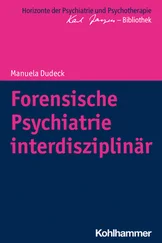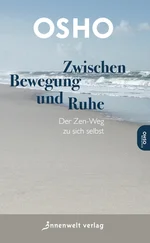Mario Gmür - Psychiatrie in Bewegung
Здесь есть возможность читать онлайн «Mario Gmür - Psychiatrie in Bewegung» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Psychiatrie in Bewegung
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Psychiatrie in Bewegung: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Psychiatrie in Bewegung»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Psychiatrie in Bewegung — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Psychiatrie in Bewegung», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
3.Texte von Schizophrenen
Heroinsucht
4.Die Konzeptualisierung der Methadon-Behandlung von Heroinabhängigen
5.Die Grenzen der Methadonbehandlung von Heroinfixern
6.Die Methadonbehandlung von Heroinfixern – Konzept einer Therapiepolarisierung
7.Spritzenabgabe an Fixer – eine dringliche Massnahme
Mediengesellschaft
8.Wenn das Rampenlicht zerstörerisch wirkt – Beobachtungen zum Medienopfersyndrom (MOS)
9.Das Medienopfersyndrom
10.Negative Auswirkungen der Informationsgesellschaft
11.Das isovalente Zeitalter
12.Auf dem Weg zur total isovalenten Gesellschaft – Die Untergangskomödie der Intimität
Gewalt
13.Wahnsinnstat – wie es dazu kommen kann
14.Mörder
15.Der Richter und sein (forensischer) Denker
16.Ethische Wegweiser für Prognosestellung und Psychotherapie im Strafrecht sowie Straf- und Massnahmenvollzug
17.Missbrauchgefahr in Psychiatrie und Strafrecht
18.Psychotherapeutische Zwangsjacke
19.Elend und Verantwortung der forensischen Psychiatrie
Glücksspielsucht
20.Sozialkonzepte sind ein Witz
Überzeugung
21.Überzeugung und die Identität stiftenden Mechanismen
22.Wie ist meine Überzeugung beschaffen? Überzeugungstypen
23.Im Zweifel für den Zweifel
24.Stimmt es, dass Wissen dumm macht?
Narzissmus
25.Was ist Narzissmus?
26.Mutterglück … Ewige Brück
Biografie
27.Sauber ist, wenn man den Dreck nicht mehr wegbringt
28.Weihnachtsferien im Irrenhaus Rosegg
29.Die Probevorlesung
30.Die Seele landet im Giftschrank
31.Die letzten Hosen von Canetti
32.«Hast Du Legitimationskarte?» Über die Schweizermacherei
Vorwort
Als ich am 1. Dezember 1970 meine erste Arbeitsstelle als Assistenzarzt in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich antrat, sahen Lebenswelt und Psychiatrieszene anders aus als heute, weltweit und in der Schweiz. Vieles war nicht oder nur wenig bekannt: Laptops, Smartphones, Lokalradio und -fernsehen, tägliche Gratiszeitungen, Spielbanken und Spielsucht, Heroin und Heroinabhängige, Methadonbehandlungen, eine Vielzahl von heute gebräuchlichen Psychopharmaka. Die psychiatrischen Kliniken waren überwiegend geschlossen und Elektroschocks noch eine gängige Behandlung. Viele heutzutage selbstverständliche Dinge und Einrichtungen erlebte ich im Prozess ihrer Entstehung. Ich habe sowohl die Öffnung und Liberalisierung der Psychiatrie mit dem Aufschwung der Sozialpsychiatrie bis zu den neunziger Jahren als auch die seither erfolgten restaurativen Rückschritte mit dem Aufkommen einer kalten algorithmischen Diagnostik und einer repressiven Psychotherapie, besonders in der Gerichtspsychiatrie, erlebt.
Während meiner Tätigkeit als Psychiater – bis 1989 in psychiatrischen Kliniken und sozialpsychiatrischen Behandlungszentren und seither in der freien Praxis – war es mir immer wieder ein Bedürfnis, mich zu jeweils aktuellen und zum Teil umstrittenen gesellschaftspolitischen und psychiatrischen Entwicklungen zu äussern. Bei den publizierten Erfahrungsberichten, Konzeptualisierungsversuchen und kritischen Stellungnahmen war mir deren allgemeinverständliche Form Anliegen und Verpflichtung.
Der vorliegende Sammelband, der auch biografische Texte enthält, ist kein nachträglich verfasstes Erinnerungsbuch, sondern eine Zusammenstellung von unveränderten Originalbeiträgen in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern. Sie gibt dem Leser auch Anregung, sich auf die Ursprünge heutiger Gegebenheiten zu besinnen.
Zürich im Dezember 2017, Mario Gmür
SCHIZOPHRENIE
1.Der Schizophrene als Partner in der hausärztlichen Behandlung
Aus:Schweizerische Medizinische Wochenschrift 112 (1982): 1735–41, April 1980
Die Entwicklung der Psychiatrie im letzten Jahrzehnt war gekennzeichnet durch den Trend zur Dezentralisierung des psychiatrischen Geschehens von der zentralen Großklinik in den peripheren Lebens und Wirkraum von Familie, Beruf und Krankheit. Die Fortschritte der Psychopharmakologie und die Errichtung sozialpsychiatrischer Einrichtungen (Nachtkliniken, Tageskliniken, Ambulatorien) haben zu dieser zentrifugalen Entwicklung beigetragen und gleichsam den Schizophrenen der Gesellschaft zurückgegeben. Die Behandlung des Schizophrenen, insoweit es dazu kommt, geschieht vermehrt im Ambulatorium und/oder in der hausärztlichen Praxis. Kernstück jeder Konsultation ist neben dem Krankheitsangebot des Patienten, welches das Heilungsritual des Arztes herausfordert, die einfache Begebenheit, daß ein Patient zu uns kommt und von uns geht. In diesem Kommen und Gehen des Patienten drückt sich eine Aktionsdynamik aus, die eine innere emotionale Bewegung wiedergibt, die ihre Resonanz in der ärztlichen Reaktion von Empfangen und Entlassen (mit einem neuen Termin für die Wiederholung dieses Konsultationsrituales) sucht. Der Ablauf «Begegnung, Trennung und Wiederbegegnung» stellt einen sozialpsychologisch-dialektischen Zirkel dar, dessen Handhabung zur kardinalen Bewährungsprobe in der ärztlichen Konsultation im verstehenden Eingehen auf den Patienten wird. Die oft hintergründige Motivation des Patienten konstelliert sich und tut sich uns in einer szenischen Situation kund, die durch das Erscheinungsbild des Patienten, sein Kommen, Fragen, Fordern und Gehen, geprägt wird. Hausarzt sein und Medizin praktizieren heißt da: Situationen erleben. Dies begründet die Notwendigkeit, das Wesen der Krankheit aus dem Situationskontext der Arzt-PatientenBegegnung zu begreifen und darzustellen.
Situationen
Der klinikentlassene Patient (Überweisungssituation)
Als Folge der psychopharmakologischen und milieutherapeutischen Fortschritte werden Schizophrene heute häufiger als früher dem Arzt zur Nachbehandlung überwiesen. Diese Überweisung ist oft mit der Hoffnung und dem Auftrag verbunden, Rückfälle und Wiederhospitalisierungen zu vermeiden. Schon beim Lesen des Entlassungsberichtes ergeben sich dem Hausarzt Hinweise oder Fragen, die sich auf die Umstände der Entlassung beziehen: Ist der Patient geheilt entlassen worden? Steht er noch unter Psychopharmaka, die ihn vor einem Rückfall bewahren sollen? Ist er gegen ärztlichen Rat, vor der Ausschöpfung stationärer Möglichkeiten, vorzeitig ausgetreten, und hat die angeordnete ambulante Betreuung die Heilungs-und Besserungsschritte nachzuholen, die in der Klinik unterlassen wurden? Ist der Patient krankheitsbewußt und zur Nachbehandlung freundlich eingestellt? Welche Vorstellungen und Erwartungen trägt er bezüglich der Behandlung in sich? Wird er kommen? Zum vereinbarten Termin? Soll ich ihn behandeln, wenn er sich dagegen sträubt? Ist die Diagnose mit ihm zu besprechen? – Diese Fragen beziehen sich auf die äußeren Randbedingungen im Vorfeld der Konsultation und finden oft keine eindeutigen Antworten, weil die Motive des kommenden oder ausbleibenden Patienten im Irrationalen begründet sein mögen: Der Patient ist zwar nicht krankheitsbewußt, aber kommt pünktlich zur Konsultation aus Gehorsam gegenüber der Anweisung des Klinikarztes. Er kommt, weil er sich gerne dem Ritual einer ärztlichen Spritze unterwirft, ohne daß ihn die sachliche und fachliche Relevanz kümmert. Oder er sieht im Arzt schlicht einen Gesprächspartner, dem er von Zeit zu Zeit einen Höflichkeitsbesuch abstattet und von dem er zuhörende Präsenz und tatkräftigen Beistand erwartet, etwa in Form eines Zeugnisses zur Befreiung vom Militärdienst oder anderer Dienstleistungen.
Was geht im Schizophrenen Schizophrenes vor?
Daß der Patient, der uns aufsucht und den wir für 10–30 Minuten in unserer Agenda eingeschrieben haben, schizophren ist, wissen wir oft nur vom Hörensagen oder von Krankheitsberichten, manchmal von persönlicher früherer Erfahrung mit ihm. Nichts weist im gegenwärtigen Moment darauf hin, daß da eine Schizophrenie vorliegt. Er ist voll besonnen, freundlich, gesprächig. Vielleicht etwas kontaktarm, wortkarg und gefühlsmäßig stumpf, oder er zeigt einige sonderlingshafte Merkmale. Zeichen einer Schizophrenie? Residualsymptome?, oder Wetterleuchten eines herannahenden schizophrenen Gewitters? Uns interessiert, was sich in seinem Innenleben abspielt, aus welchem wir einige Signale empfangen. Ein Eindringen in seine Innenwelt durch bohrendes und symptom-orientiertes Fragen ist da wohl verfehlt, würde vom Patienten als ein verletzendes Herumstöbern in seiner Intimsphäre oder als ein Aufwühlen schmerzlich erlebter Vergangenheit empfunden. Die Psychopathologie leistet uns da einige Hilfe, allerdings nicht als ein Konglomerat von feststellbaren Einzelsymptomen, sondern als ein nachvollziehbares dynamisches System innerer psychischer Vorgänge, die sich, für uns wahrnehmbar und beobachtbar, an die Oberfläche als psychopathologische Symptombildungen projizieren. Nicht dieser Oberfläche des Symptombildes gilt unsere Zuwendung, sondern dem Geschehen im Patienten, das wir am besten zu erfassen vermögen, wenn wir Analoges im Gesunden suchen. BLEULER hat dieses Verständliche etwa im Begriffe der Ambivalenz gefunden und geprägt, das jedem Menschen vertraut ist als Hin- und Hergerissen sein zwischen Wollen und Nichtwollen, Tun und Nichttun usw. Die Lebenserfahrung lehrt uns, daß demjenigen, wogegen wir mit besonderer Heftigkeit den Donnerkeil unserer Empörung schleudern, oftmals auch unsere besondere Zuneigung gilt. Zitate der Literatur bringen diese Widersprüchlichkeit zum Ausdruck. Etwa: «… ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft …», «Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Psychiatrie in Bewegung»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Psychiatrie in Bewegung» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Psychiatrie in Bewegung» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.