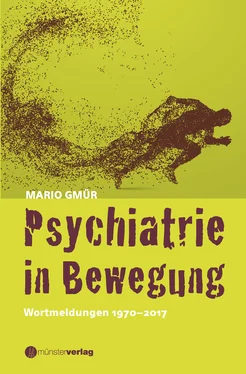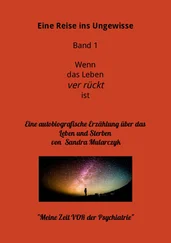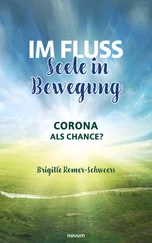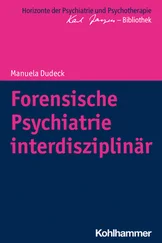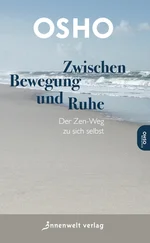Zur Wandlung des Schizophrenieverständnisses
Durch die grundlegenden Arbeiten von Griesinger (2) und Eugen Bleuler (3) hat sich unsere Einstellung zur Schizophrenie von einer fatalistisch-statischen zu einer optimistisch-dynamischen Haltung gewandelt. Griesinger markierte die Wende von der romantischen Psychiatrie, welche die Krankheit als moralische Verfehlung verstand, zu einer organisch ausgerichteten Psychiatrie, welche die Wurzeln psychischer Veränderungen in der Gehirnsubstanz lokalisierte. Mit Eugen Bleuler wich die Vorstellung eines unbeeinflussbar ablaufenden organischen Prozesses der Erkenntnis einer Dynamik sich widerstreitender Kräfte, die ihren Ursprung in der gegenwärtigen und vergangenen Innen und Aussenwelt, in der Anlage, Umwelt und Biographie haben. Die naturwissenschaftlich erklärende Psychologie wurde so durch die verstehende Psychologie erweitert. Dieser neue wertphilosophische Stellungsbezug erhob den Patienten vom Objekt distanzierter Betrachtung und distanzierender Ausschliessung zum Partner diagnostischer und therapeutischer Auseinandersetzung. Als neue therapeutische Methode gewann das ärztliche Gespräch zentrale Bedeutung. Hauptmerkmal dieser Neuorientierung waren in den 50er Jahren unseres Jahrhunderts die Intensität und die Beflissenheit, mit welcher Psychotherapien an Schizophrenen von Psychoanalytikern im Burghölzli ausgeübt wurden. Diese war genährt vom Bestreben und Eifer, die Heilbarkeit der Krankheit zu erweisen. Die therapeutische Auseinandersetzung, meistens an schizophrenen Patienten in der «verfügbaren» stationären Situation in der geschlossenen Klinik praktiziert, blieb damit Werkzeug in der psychotherapeutischen Werkstatt des Arztes, der Patient Therapieobjekt. Heilungsbeweise wurden in Einzelfällen erbracht, waren jedoch eher die Ausnahme. Was uns von dieser Ära psychoanalytischer Intensivtherapie erhalten geblieben ist, ist das Bekenntnis zum therapeutischen Engagement am Patienten, das heute unter den Titeln von Ergotherapie, Milieutherapie und Betreuung unter Einschluss der Psychopharmakologie weiterlebt. Neuere Ansätze und Anläufe zu psychodynamischem Verständnis und psychotherapeutischen Aktivitäten in den letzten Jahren waren oft von dem Bemühen gekennzeichnet, diesen vorausgehend diagnostisch-nosologische Umdefinierungsstrategien, quasi als Legitimation, zugrunde zu legen. «Schizophrene Reaktion», «Borderline», «narzisstische Neurose» – Diagnosen, die sich vorübergehend oder bleibend in Diagnoseschlüsseln und auf Austrittsberichten neuerer Auflage festsetzen – sind wohl geeignet, einen neuen therapeutischen Optimismus zu nähren. Dies durch ihre in der Wortwahl zum Ausdruck gebrachte Schonhaltung und ihre Abschwächungseffekte gegenüber der gesellschaftlich immer noch stigmatisierten Diagnose «Schizophrenie», durch die Andeutung von Interpretierbarkeit und milieubezogener Bedingtheit und durch ihre Verführung zu therapeutischer Beeinflussung: Schizophrene Reaktion – nur eine Reaktion, Borderline – lediglich ein Grenzfall, narzisstische Neurose – behandelbar, zum Glück keine Schizophrenie, wird uns mitunter suggeriert, zumindest da, wo diese neueren diagnostischen Etikettierungen auf die herkömmliche Schizophrenie angewandt werden. Die theoretischen Ansätze psychodynamischer und entwicklungspsychologischer Richtung ( Kohut, Kernberg u. a.) haben unseren Verständnis- und Handlungsspielraum im Umgang mit kranken Menschen in einer Weise erweitert, dass sie der Verwertung für nosologische Neuorientierungsstrategien entsagen können und uns mehr bringen, wenn sie als allgemeine Psychologie des Menschen für die ärztlich-psychotherapeutische Arbeit Verständnis- und Handlungshinweise geben. Dies gilt auch für die Behandlung der Schizophrenie (4, 5).
Verharmlosende Umdefinierungen der Schizophrenie könnten sich nur allzuleicht zur raffiniertesten Variante der Intoleranz gegenüber dieser Lebenserscheinung auswachsen, weil sich Ablehnung, ja Diskriminierung hier ins Gewand von wissenschaftlich fundiertem Altruismus hüllt. Sie entpuppten sich als verschlüsselte Form der Ausschliessung und Absonderung, der Exkommunikation von Schizophrenie und des Schizophrenen, die sich handfester Anfechtbarkeit mehr entzieht als etwa offene institutionelle Isolierung. Gerade gegenüber Schizophrenen offenbart die Heilsbemühung des Arztes mitunter ihr Janus-Gesicht: Heilen heisst, im Patienten das Gesunde fördern, aber auch die Krankheit ablehnen. Insoweit der Patient mit seinem Denken und Fühlen, seiner Krankheit eins ist, gerät er also nur allzuleicht in die Lage, dass er sich einem Helfer gegenübersieht, der ihn ablehnt. Solcher Widersprüchlichkeit können wir uns entziehen, wenn wir anerkennen, dass jede Krankheit ihr Gutes und ihr Schlechtes haben kann.
Welche Behandlungstechniken auch immer erfunden, entwickelt und appliziert werden – Psychopharmaka, Familientherapie, Psychoanalyse, Milieutherapie –, sie erliegen oft der Gefahr, unsere Beziehung zum Patienten zu instrumentalisieren, diesen zum Objekt therapeutischen Handelns zu degradieren und die Schizophrenie zu einer besiegbaren Krankheit zu verdinglichen. Es sei den Forschungsbemühungen nicht die Berechtigung abgesprochen, Kampfinstrumente und -strategien gegen die Krankheit zu entwickeln, doch hat deren Verwendung stets den situativen Kontext der Krankheit zu beachten, den ich als therapeutische «Quartettsituation» chrakterisieren möchte, konstelliert durch die vier Elemente Krankheit, Therapie, Arzt, Patient. In Abwandlung eines Dichterzitates wäre die Situation des Arztes mit den Worten zu beschreiben: Es werden Patienten bestellt, es kommen Menschen. Die Quartettsituation reduziert sich auf eine Dualsituation in dem Masse, wie Arzt und Therapie hier, Patient und Krankheit dort zu einem einheitlichen Ganzen verschmelzen. Der Patient, der nicht «krankheitseinsichtig» sei – er ist mit seiner Krankheit eins. «Der Arzt als Droge» ist mit seiner Therapie eins, auch in der Handhabung seiner Instrumente.
Der Patient in der Praxis
Patienten sind in der hausärztlichen Praxis (wie auch im Leben) anders als in der Magistralvorlesung. Weshalb? Im Hörsaal richtet sich das Augenmerk von Dozent und Publikum in synthetischganzheitlichem Verständnisbemühen auf Symptome, Syndrome und Krankheit.
Der «vorgeführte» Patient als Träger der Schizophrenie verschwindet gleichsam im Kleide seiner Pathologie, das sich einmal mehr wallend und buntscheckig, einmal mehr bescheiden und farblos vom Dozenten ausgebreitet und kommentiert, dem Auditorium darbietet. Demonstration und Vortrag begründen als Rüstzeug die Wissensvermittlung von Krankheitszusammenhängen in ihrem Pathologiebezug. Ausgespart bleibt oft der «Sitz im Leben» und, da mit zusammenhängend, die Beziehung zwischen Arzt und Patient, dort, wo sie sich im Alltag gewöhnlich herstellt, nämlich in der ärztlichen Praxis als ärztliche Konsultation.
Hier richtet sich unser Interesse nicht nur auf das Erscheinungsbild, sondern auch auf das Erleben des Patienten. Nicht was er hat, sondern wie er ist und wie er auf uns wirkt, ist oft für unsere Einstellung zu ihm massgebend. Von Bedeutung ist, dass sich die schizophrene Veränderung nicht wie ein somatisches Leiden als ein Vorgang am, sondern im Patienten abspielt und somit sein Urteil und seine Einsicht primär mit einbezieht. Die Veränderung, von Conrad (6) als verändertes Bedeutungsbewusstsein charakterisiert, geht also, wenn auch graduell verschieden, auf der Subjekt- und nicht auf der Objektstufe vor sich. Je nachdem, wie peripher (objektal) oder zentral (subjektal) sich dieses schizophrene Geschehen abspielt, stellt sich beim Patienten Krankheitseinsicht ein. Der folgende Abschnitt soll uns diesen Vorgang verständlich machen.
lch-synton –ich-dyssynton (= ich fremd}
Читать дальше