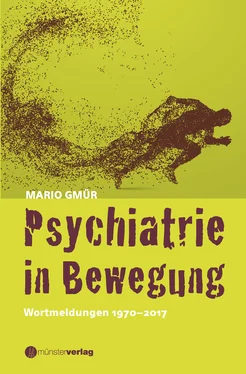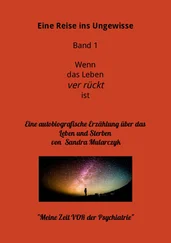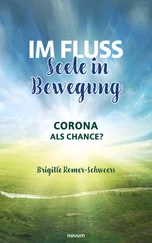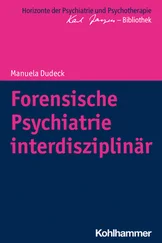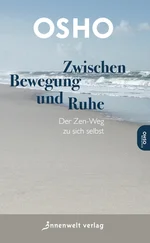Viele Patienten, die an einer Schizophrenie leiden, lehnen Medikamente rundweg ab, auch wenn sie von Stimmen gequält werden bis zur Verzweiflung und sich in Klagen darüber ergehen. Aussichtslos, ihnen die Medikamente mundgerecht zu machen, obwohl sie in ihrer Raserei und rastlosen Getriebenheit auch schon ihre Wohnung beschädigt haben und eine Hospitalisierung nicht mehr abwendbar scheint. Der Widerstand gegen die Medikamente ist gewöhnlich nicht zu brechen, und es ist meist auch nicht ergiebig, viel Mühe darauf zu verwenden, denn die Abwehr hat ihre Wurzeln in tiefen Verlustängsten: Da ist einmal die Angst des Schizophrenen, die inneren schizophrenen Objekte, die er gegen seine drohende Selbstauflösung aufgerichtet und mit denen er sich versöhnt und arrangiert hat, zu verlieren. Die Medikamente würden ihm seine blühende Schizophrenie wegnehmen, mit welcher er ein leeres, hohles Innenleben ausstattet. Wer garantiert ihm, daß es ihm ohne diese besser gehen wird? Eine weitere Quelle seines Widerstandes gegen Medikamente ist die Angst vor Kontrollverlust. Auch in seinem psychotisch aufgelösten Zustand behält er, beobachtend und agierend, die Kontrolle über die inneren und äußeren Vorgänge, die er sich nicht entwinden 1assen will. Erzwingen wir die Medikamenteinnahme, so steigert sich seine Angst zu einer höllischen Panik, die ihn wohl sein Leben lang gegen die Medizin stimmt, welche ihm kaum jemals als rettender Engel, sondern als unmittelbarer, wissenschaftlich verbrämter Vertreter der bösen nackten Gewalt entgegentreten wird. Da lassen wir besser die Medikamente beiseite und begnügen uns damit, der weiteren Entwicklung zu harren. Nicht selten wendet sich von selbst das Blatt, und der Patient telephoniert oder erscheint unvermittelt mit dem überraschenden Begehren nach Medikamenten.
Die Angst vor dem Kontrollverlust präsentiert sich freilich in den verschiedensten Variationen: Der eine Patient rettet seine Kontrolle, indem er in ultimativem Befehlston dem Arzt gebietet, unverzüglich die Spritze zu verabreichen. Bei einem anderen fahren wir gut, wenn wir ihm ein Semap (perorales Wochenneuroleptikum) mitgeben für den Gebrauch nach eigenem Gutdünken. Und ein Dritter fühlt sich einer eigenen angstmachenden Verantwortung nur dann enthoben, wenn er sich dem eindeutigen Imperativ der ärztlichen Anordnung auf der Stelle unterziehen kann. Die Auflehnung gegen ärztliche Medikation findet indessen noch weitere, durchaus rational begründete Erklärungen, nämlich die Angst vor Nebenwirkungen, wie Adipositas, Müdigkeit, vegetative und extrapyramidale Begleiterscheinungen, die von früheren Behandlungen als lästig und hinderlich in Erinnerung sind.
Zum Thema medikamentöse Dauerbehandlung (Beispiel: eine Dapotum-Spritze alle drei Wochen oder ein Semap pro Woche): Es ist eine Erfahrungstatsache, daß viele Patienten unter kontinuierlicher neuroleptischer Behandlung symptom- und rückfallsfrei sind und ein unauffälliges Leben in Familie, Gesellschaft und Arbeit führen. Manche bleiben psychisch und sozial von der Krankheit gezeichnet, können sich aber wenigstens außerhalb der Klinik halten. Das Bewußtsein, «dank der Medikamente» von einem Rückfall verschont zu bleiben, ist die zuverlässigste Motivation für eine kontinuierliche Behandlung. Oft gibt es aber auch andere Gründe, dem Arzt über Jahre die Treue zu halten: Sympathie, Gehorsam, Gewöhnung. Zieht sich die Behandlung in die Länge, über Monate und Jahre, so stellt sich indessen beim Patienten, wie auch immer seine Motivation gelagert ist, und oft auch beim Arzt eine Langeweile ein, die zur Sinn-und Zweckfrage veranlaßt: Wenn es dem Patienten so konstant gut geht, ist die Fortsetzung der Medikation noch angebracht? «Muß ich (er) das Leben lang Medikamente einnehmen?»
Ursprünglich eingeleitet zur Behebung einer Krise, nimmt die Neuroleptikabehandlung auf die Dauer zunehmend einen prophylaktischen Charakter an, dies im Unterschied etwa zu einer analgetischen Behandlung, wo der Kranke sich, durch das Wiederaufflackern des Schmerzes bei Dosisreduktion, täglich der therapeutischen Wirksamkeit vergewissern kann. Geht die unmittelbare Erfahrungsevidenz des Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs einer Medikation verloren, so verschwinden oft auch das Verständnis dafür und die Bereitschaft, die Disziplin zur regelmäßigen Medikamenteinnahme aufzubringen. Dem Reiz, sich wieder ohne den Artefakt chemischer Beeinflussung als Nativpersönlichkeit zu erfahren, ist schwierig zu widerstehen. Die Monotonisierung der Langzeitbehandlung weckt den Wunsch nach Änderungen und Dynamisierung. Vorerst stellt uns der Patient nur die Frage, weshalb er der Medikamente noch bedürfe und was diese in ihm noch bewirken. Ich knüpfe hier meist an seine früheren Erfahrungen an und entgegne, das Medikament bewahre ihn vor Rückfällen in die Krise, schirme ihn vor der Überflutung durch innere Ängste und Impulse ab. Eine solche Erklärung vermag die Motivation des Patienten oft zu verlängern. Sträubt er sich jedoch unvermindert gegen die Medikation, so erweist sich jede therapeutische Zwängerei unsererseits als unfruchtbar. An die Stelle der persuasiven Bemühungen hat unser Respekt für die subjektive Sicht des Patienten zu treten, für welche wir nun Verständnis bekunden, indem wir den Medikamenten-Absetzversuch zu einem gemeinsamen therapeutischen Programm gestalten, während welchem die Beziehung aufrechterhalten bleibt. Absetzversuche haben in der Regel kein unmittelbares Rezidiv zur Folge, welches sich meistens erst nach Monaten entwickelt. Eine unaufdringliche Empfehlung an den Patienten, bei Anzeichen von Verschlechterung die Behandlung wieder aufzunehmen, genügt in vielen Fällen, um Wiederhospitalisierungen zu vermeiden.
Die Einstellung zur Klinik in der Ambulanz
Vielerorts stehen psychiatrische Kliniken auch heute noch in einem anrüchigen Ruf. Sie werden despektierlich als Spinnwinden bezeichnet und als Aufbewahrungsstätte für Verrückte und Halbverrückte betrachtet. Ungeachtet der Modernisierung des intramuralen und extramuralen Psychiatriebetriebes lebt die Dämonisierung der Klinik fort und bewirkt eine Abschreckung auf behandlungsbedürftige Patienten, zu einem gewissen Grade indessen auch eine Attraktivität auf neue Psychiatergenerationen, die Einblick in die «Welt der Verrückten» nehmen. In den letzten Jahren entwickelten viele Psychiater der jüngeren, «sozialpsychiatrischen» Generation den Ehrgeiz, Hospitalisierungen um jeden Preis zu vermeiden. Generelle, zeitbedingte Vorurteile gegen die Klinik gilt es von der persönlichen Einstellung des Patienten abzugrenzen, die sich aus dessen eigener Krankheitserfahrung und persönlichem hautnahen Kontakt mit der psychiatrischen Klinik herausbildet. Oft ist es eindrucksvoll, wie nachhaltig und hartnäckig der Akt der Hospitalisierung und die ersten Stationserlebnisse von Patienten mit Empörung erinnert und angeprangert werden, und dies oft in krassem Gegensatz zu ihrer mitunter langjährigen passiven Ergebenheit gegenüber dieser Institution, aus welcher auszutreten sie keine Anstalten machen, oder umgekehrt trotz benignem Verlauf, der ihnen einen baldigen Austritt ermöglichte. Diese oft so festgefahrene und unverrückbare klinikfeindliche Haltung liegt teilweise in der Krankheit begründet: Der Zustand des hospitalisierungsbedürftigen Patienten ist ja meist ein akuter und bedarf deshalb allergrößter Vorsicht und Sorgfalt unsererseits, weil der Kranke sich gewissermaßen in einer verletzlichen Phase befindet, voller Angst und Mißtrauen gegenüber allem, was auf ihn zukommt. Wenn wir noch so sachgerecht mit ihm umzugehen meinen, verletzen wir ihn: unsere interessierte Miene und unser eifriges Notieren bei der Exploration und Einweisung geben dem Wahngestimmten die Gewißheit, daß wir Abgesandte der Kriminalpolizei sind, und wenn er dann von Sanitätsbeamten weggeführt wird, steigert sich diese zur Überzeugung, daß er das Opfer einer Deportation zu einer Hinrichtungsstätte wird, Stoff genug für eine Legendenbildung, die vielleicht lebenslang unverändert erhalten bleibt.
Читать дальше