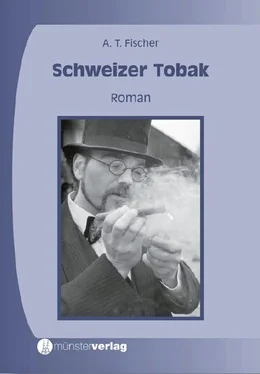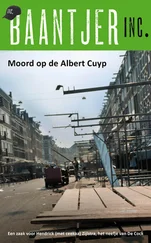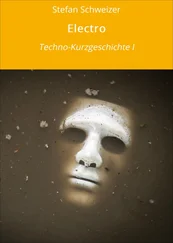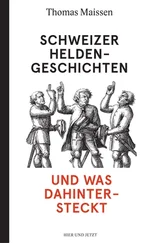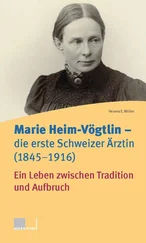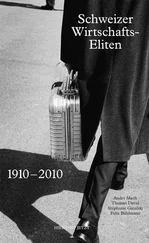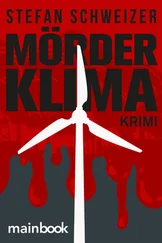Er begann sich für Einzelschicksale, Herkunft und Lebensläufe von Menschen, die er aus seiner Jugendzeit oder Kindheit kannte, zu interessieren. Dieses Interesse war auch durch sein eigenes Erleben motiviert. Wenn es so etwas wie Liebe gab, hatte ihn diese nach Frankreich entführt. Miriam war für ihn einfach unwiderstehlich gewesen. Ihr Gesicht hatte fröhliche Unbefangenheit ausgestrahlt, und in allem, was sie sagte, war Zuversicht, Freude auf gutes Gelingen und frohe Tage gelegen. Er erlebte sie als Gegenpol zu seiner Mutter, die sich stets sorgte, sich vor jedem kommenden Tag fürchtete oder ihm mindestens ohne Hoffnung auf Gutes und Schönes entgegensah. Er selbst neigte zu dieser Gemütslage und Miriam hatte ihn da herausgeholt und in einem gewissen Mass auch mitgerissen.
Er hatte seine Mutter kaum lächeln sehen, mit Miriam zusammen sah er sie sogar lachen. Aber Miriam wollte nicht in der Schweiz leben. «C’est beau, la Suisse, tu sais, mais un peux étouffante …», und sie sagte dies mit grossem Charme.
Andrés Vater war offensichtlich irgendwie mit dem deutschen Faschismus verstrickt gewesen. Sein Sohn scheute sich jedoch sein Leben lang, aus Respekt vor seinen Eltern, dieses Thema anzusprechen. Aber der Mann hatte nun einmal Brand-Cigars in München in den letzten Jahren vor und während des Krieges bis kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner geleitet. Ohne ein Mindestmass an Linientreue hätte er diese Stellung nie bekommen oder gar halten können. Auch der Grossvater, der in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg im Auftrag der legendären Mama Brand für Brand-Cigars nach Deutschland gezogen war, konnte sich dem Einfluss der Entwicklung zum nationalsozialistischen Deutschen Reich nicht entziehen. Allerdings verliess er Deutschland mit seiner Frau, als die Horden der paramilitärischen SA im Rassenwahn in den Strassen der Städte alles kurz und klein schlugen, was als jüdisch galt oder aussah – aus Altersgründen, wie er die braunen Behörden ausdrücklich wissen liess. Der alte Sebastian – so nannten ihn auch «seine» Arbeiterinnen und Arbeiter am Starnberger See – war damals 63 Jahre alt.
Er kaufte in der Schweiz durch die Vermittlung der Brands über dem See dieses schöne Haus. Er erlebte jedoch das Ende des Krieges nicht, er starb im März 1945, nur wenige Wochen vor dem grausigen Tod seines Schwiegersohnes und kaum zwei Monate vor dem Ende des Hitlerreichs. Schon nach dem Fall von Stalingrad wusste Sebastian, dass der Krieg für Deutschland verloren war, doch sprach er nie darüber, er setzte aber nach diesem Zusammenbruch der Ostfront alle Hebel in Bewegung und bat auch Marcel Brand, den Nachfolger der inzwischen verstorbenen Mama Brand, um Unterstützung, um seine Tochter Irma mit ihren Kindern – durch die Heirat waren sie deutsche «Reichsangehörige» geworden – auf Dauer in die Schweiz «heimzuholen», wie er es nannte.
Der Vorgang war kompliziert, ein Doppelbürgerrecht gab es nicht und die Familie konnte auch nicht den Status von Flüchtlingen annehmen, das hätte den als Leiter der Niederlassung zurückgebliebenen Vater in Schwierigkeiten bringen können. Er durfte nicht in den Verdacht eines Defätisten geraten, das war lebensgefährlich und zudem auch ein Risiko für die deutsche Brand-Cigars.
Es gelang nur Dank der Hilfe eines befreundeten Arztes, der sowohl bei der Mutter wie auch bei dem am 6. Juni 1944 geborenen Säugling Andreas eine Lungentuberkulose attestierte und die beiden älteren Kinder als schwer gefährdet einstufte. Nachdem sich die Werths bereit erklärt hatten, die Kosten einer Kur bis zur vollständigen Heilung in den Schweizer Bergen selbst zu tragen, lenkte der an sich sehr misstrauische, aber letztlich auch für kleinere und grössere Geschenke empfängliche Amtsleiter für Auslandsaufenthalte ein.
Es war eine Zitterpartie. Beinahe systematisch wurden im «Reich» unheilbar Kranke – Tuberkulöse galten mindestens als sehr schwer und selten heilbar – einer Heilstätte zugewiesen. In der Regel erhielten die Angehörigen nach kurzer Zeit die Mitteilung, die Patienten seien an den Folgen des Leidens gestorben. Nicht immer, aber hin und wieder und selbstverständlich nur für Nichtjuden waren andere Lösungen möglich.
Sebastian musste in Kauf nehmen, dass sein für seine Tochter im «Reich» angespartes und noch immer dort liegendes Geld als Bürgschaft gesperrt wurde. Das war zwar unschön, aber zu verschmerzen.
Im September, als die Amerikaner Frankreich befreiten, verbrachten Sebastians Enkel und seine Tochter die ersten Wochen in der neuen Heimat, in der deutschen Heimstätte von Davos. Die Wahl dieses Kurortes in Graubünden war für die Nazis unverdächtig. Während der Hitlerzeit galt die Stadt in den Bergen, vor allem seit dem Mord an Gauleiter Gustloff, als eine Drehscheibe deutscher Maulwürfe des Dritten Reichs.
Als ob er seine letzte Kraft für diesen Vorgang verbraucht hätte, erkrankte Sebastian wenige Wochen nach der Ankunft seiner Lieben. Damit begann für ihn eine lange und nicht nur sehr schmerzhafte, sondern auch kostspielige Leidenszeit. Bedingt durch den damaligen Zeitgeist, aber auch durch seine Biographie hatte Sebastian keine in der Schweiz einsetzbare Krankenversicherung. Irma wurde sehr schnell klar, dass ihre Eltern an ihren Kosten in Davos ausbluteten. Sie brach ihren «Kuraufenthalt» in den Bergen kurzerhand ab und zog noch vor Weihnachten ins Haus am Heimberg über dem See. So konnte sie auch ihrer Mutter helfen, über den gesundheitlichen Zerfall ihres Mannes hinwegzukommen.
Irma wollte arbeiten. Bei Brand-Cigars fand sich eine Stelle im Lohnbüro und ihre Mutter übernahm die Aufsicht auf die Kinder.
Nach den Herbstferien besuchten Elisabeth und Konrad die reguläre Dorfschule. Die Grossmutter hütete zu Hause den noch nicht jährigen André, während Irma ihrer Arbeit nachging. Diese Arbeit war für sie erlösend, nicht nur, weil sie damit zu einem Einkommen kam, sondern auch, weil sie sich ablenken konnte und sie sich nicht dauernd mit der Katastrophe, die der scheussliche Krieg in ihr Leben gebracht hatte, auseinandersetzen musste.
In einem Brief hatte sie versucht, ihrem Mann ihre Entscheidungen verständlich zu machen. Telefonate nach Deutschland waren beinahe unmöglich und wenn, wurden sie abgehört. Das wollte Irma nicht riskieren. Auch wurden sämtliche Briefe geöffnet, gelesen und nach Belieben zensiert oder gar konfisziert. Doch sie wählte einen unverfänglichen Text, sie schrieb, als wäre sie eine ehemalige Mitarbeiterin von Brand-Cigars, die sich an ihre Münchner Zeit erinnerte, von ihren Kindern erzählte und hoffte, ihn in besseren Zeiten besuchen zu können. Sie war überzeugt, ihr Mann würde, im Gegensatz zu den Zensoren, die wirkliche Botschaft verstehen.
Sie hatte auf ihren Brief nie eine Antwort erhalten. Einen Monat später war ihr Vater gestorben und kurz danach erhielt sie die Nachricht vom schrecklichen Tod ihres Mannes und Vaters ihrer Kinder.
Soviel wusste André. Er würde versuchen, mehr zu erfahren, nahm er sich vor.
Das grosse Dorf hatte sich in den vergangenen 40 Jahren viel stärker verändert, als er dies in den ersten Tagen wahrgenommen hatte. An jeder Ecke waren neue Wohn- und Geschäftshäuser entstanden, vor allem auch im langgezogenen Zentrum des Dorfes entlang der Haupt- oder Durchfahrtsstrasse.
Überall standen auch noch die kaum übersehbaren Fabrikgebäude der Tabakindustrie, zum Teil ordentlich instand gehalten, andere sahen eher etwas heruntergekommen oder mindestens vernachlässigt aus. Dies war ihm schon bei seinen ersten Streifzügen aufgefallen. Doch erst nach einigen Wochen begriff er, dass hinter den hohen Fenstern dieser Säle niemand mehr Zigarren wickelte. Zwar prangten an vielen Fassaden noch immer die Namen der einstigen Fabrikherren oder deren Marken, da und dort in messingglänzenden Lettern, doch die Räume dahinter wurden nun beispielsweise als Lager für alte Möbel genutzt.
Читать дальше