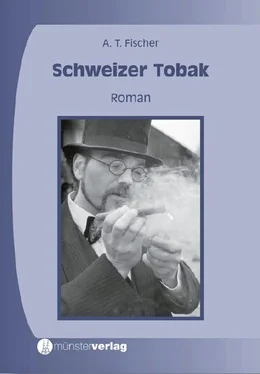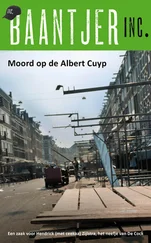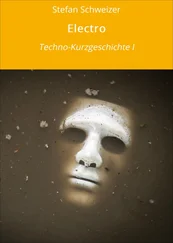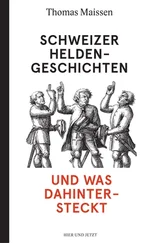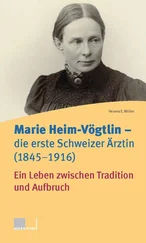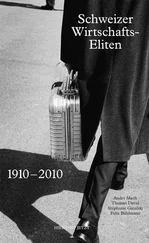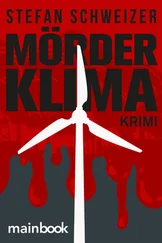Wo waren die Hunderte und Aberhunderte von Arbeiterinnen und Arbeiter der Region hingegangen? Wovon lebten alle diese Leute jetzt?
Doch das war noch nicht alles. Das Schmauchtal hatte auch Fabriken der Metallindustrie gehabt, in denen Profile, Bleche, Drähte und hochpräzise Drehbänke, Werkzeugmaschinen entstanden. Davon gab es nicht mehr viel. Tausende von Leuten, schätzte er, hatten in all diesen zum Teil riesigen Hallen und kleinen Fabriken gearbeitet. Jetzt standen sie scheinbar leer oder wurden nur noch zu einem kleinen Teil von wenigen Leuten genutzt. André erinnerte sich daran, als er als Sekundarschüler um die Mittagszeit nach Hause trödelte, wie während mehreren Minuten Hunderte von Arbeitern auf ihren durch den Fahrwind leise surrenden Fahrrädern an ihm vorbei zu ihren Mittagstischen pedalten. Es gab wenige Autos, einige Motorräder, doch um diese Mittagszeit und eine Stunde danach auf der Fahrt zurück in die Fabrik beherrschten die Fahrräder die Strasse.
Jetzt gab es sie nicht mehr, die Männer auf ihren Rädern. Wovon lebten die Menschen jetzt? All diese Fragen beschäftigten André sehr.
Im August reiste er für eine Woche an den Starnberger See zu seiner Schwester. Es galt, endlich die Erbschaft zu regeln. Die Mutter hinterliess zwar ein schuldenfreies Haus, aber darüber hinaus war nicht sehr viel geblieben. André würde also, um im Haus bleiben zu können, die Anteile seiner Schwester und Konrads Familie ausbezahlen und dabei Hypothekarschulden machen müssen. Darüber hatte er nie nachgedacht.
Das alles hatte ihm der Anwalt Peter Gramper, den Elisabeth mit den Abklärungen beauftragt hatte, erläutert und dabei auch den Vorschlag gemacht, den Nachkommen in Brasilien zu raten, das Erbe in der Schweiz zu belassen, um es vor dem galoppierenden Zerfall der brasilianischen Währung zu schützen. So blieben die Erben in Brasilien Miteigentümer des Hauses und könnten beispielsweise den anfallenden jährlichen Mietzins problemlos in Brasilien einführen.
Diese Idee gefiel auch Elisabeth für ihren Erbteil, umso mehr, als sie selbst keine Kinder hatte und das Geld für sich selbst nicht brauchte.
Anfänglich machte sich André Sorgen, wie er diese Miete mit seiner Rente schaffen würde, doch seine Bank war zu seinem eigenen Erstaunen sehr offen, man würde ihm im Hinblick auf das völlig unbelastete Haus nötigenfalls das Geld für diese Zinsen für zwei Jahre vorschiessen und in der Zwischenzeit könne er sich nach einem Zusatzeinkommen umsehen.
Zudem war André nicht mittellos. Miriam hatte ihm seinen Anteil an der gemeinsamen Wohnung ausbezahlt. Jetzt fehlte nur noch die Zusage aus Brasilien.
Eduardo, Ines und Sonja waren nie von São Paulo weggezogen. Sie lebten nach wie vor bei Silvias Verwandten. Ines, die Ältere, hatte ein Handelsdiplom geschafft und arbeitete in der Niederlassung einer grossen amerikanischen Werbeagentur.
Sonja besuchte das Lyzeum der katholischen Schule, die Elisabeth von ihrer einstigen Reise her kannte und wollte angeblich Lehrerin werden.
Keines der drei Kinder dachte je daran, seine schweizerische Herkunft und Nationalität wahrzunehmen. Ihr verstorbener Vater war eine für sie unwirkliche Erinnerung und die Umstände seines Todes erschienen ihnen noch immer als tragisches, aber gleichzeitig in ihrer Welt nicht seltenes Schicksal. Niemand in der Sippe ihrer Mutter machte davon ein grosses Aufhebens und niemand hatte je weiter versucht, die Wahrheit über die Hintergründe oder gar den oder die Täter zu finden.
Alle glaubten – oder mindestens schienen sie das zu glauben –, Konrad sei das Opfer einer bösen Organisation geworden und er hätte versucht, deren Machenschaften zu verhindern oder gar aufzudecken.
Viele der Verwandten, vor allem die Frauen, sahen in allem einfach eine Fügung Gottes. Die Männer neigten eher zur Selbsthilfe, ohne jedoch, keinesfalls offen, an Gott zu zweifeln. Das alles erzählte Elisabeth auf Grund der bisher eingegangenen Briefe und Belege.
André verbrachte ein paar gute Tage bei der alleinstehenden 70-jährigen Elisabeth. Sie bedauerte, keine Kinder und im Gegensatz zu Tante Helene auch keines adoptiert zu haben. Ihr Leben sei dazu zu unstet gewesen, meinte sie. Harald war sein Leben lang gereist und auch nach seiner Pensionierung antiken Ausgrabungen nachgegangen. Sie wollte nicht zu Hause auf ihn warten, also reiste sie, wenn immer möglich mit. Diese Art Leben hatte sie erst durch seinen Tod aufgeben müssen. Erst in neuester Zeit, nach dem Tod ihrer Mutter, mache sie sich ab und zu Gedanken über ihr eigenes Ende und ihren Nachlass. Harald wollte immer einen Teil seines Vermögens einer Stiftung schenken, habe sich jedoch nie dazu aufgerafft, etwas zu regeln. Sein Tod nach einem Hirnschlag kam unerwartet, auch er hinterliess ausser ihr keine direkten Erben. Ihrer Meinung nach könne man also mit Konrads Kindern in Brasilien grosszügig umgehen.
André brachte die Gespräche mit seiner Schwester immer wieder auf seinen Vater, seine Herkunft, sein Leben und sein schwieriges Ende. Im Gegensatz zu ihm hatte Elisabeth ihn gekannt. Sie war neun Jahre alt gewesen, als Mutter und Kinder in die Schweiz zogen, um der sich anbahnenden Katastrophe zu entgehen.
In jenem letzten Jahr vor dem Kriegsende war der Betrieb aus Mangel an Tabak beinahe eingestellt worden. Es wurde zwar noch gearbeitet, aber nur mit ziemlich minderwertigem Kraut aus deutschem Anbau. Vieles davon ging an die Truppen der Wehrmacht und der SS. Packungen und Schachteln trugen das Hakenkreuz als mehr oder weniger erzwungenes Bekenntnis zum Regime.
Lothar Werth galt als linientreu, er tat, was die rüden Parteibonzen erwarteten, er stellte auch Leute ein, die man ihm zuteilte und war Mitglied der NSDAP, das musste er sein. Man vertraute ihm auch noch, als Irma und die Kinder in die Schweiz fuhren.
Es waren Mitglieder der Gestapo, die plötzlich begannen, näher hinzuschauen. Als Irma die Heilstätte verlassen hatte und mit ihren Kindern zu den Eltern gezogen war, hatte sie von der durch die Schweizer Behörden schon ziemlich in Bedrängnis gekommene Davoser «Gauleitung» einen Hinweis bekommen. Die Frau sei jetzt geheilt, hiess es, aber warum fuhr sie nicht zurück ins Reich? Die Frau war nie krank gewesen, war die nächste Entdeckung. Der Arzt in München wurde eingezogen, unter Druck gesetzt und Lothar Werth jetzt überwacht. Man gab ihm Zeit, doch als Irmas Brief kam, war alles klar. Die ungebetenen Leser durchschauten Irmas etwas hilflosen Trick. Lothar und der Arzt gehörten zu den letzten Opfern der Nazis in München. Nur wenig später kamen die Amerikaner in die Stadt.
Die braunen Machtbesessenen hatten auch versucht, die Bundesbehörden der Schweiz auf die irreguläre Situation der vier «Reichsangehörigen» im Schmauchtal aufmerksam zu machen und ihre Auslieferung zu erwirken. Die Sache wurde in Bern schon im Hinblick auf die Kriegssituation auf die lange Bank geschoben und die Gemeinde hatte inzwischen für Irma und ihre Kinder in aller Eile die Anerkennung als Flüchtlinge beantragt. Auch dieses Gesuch wurde auf die lange Bank geschoben. Als Witwe konnte Irma in einem vermutlich beschleunigten Verfahren wieder Schweizerin werden und damit wurden auch ihre Kinder Bürger des Landes.
Lothar Werth war kein Münchner gewesen. Er kam aus dem badischen Brühl. Dort hatte 1932 ein verheerendes Feuer einen grossen Teil einer Zigarrenfabrik zerstört. Um die 50 Leute mussten entlassen werden, darunter auch der als Betriebsleiter ausgebildete Lothar Werth. Jetzt war auch klar, warum Mutter Irma nie etwas über Lothars Familie erzählt hatte, als ob es sie nicht gegeben hätte. In einem Album fanden sich zwar Bilder von Irmas und Lothars Hochzeit mit den beiderseitigen Eltern, und auch zur Taufe der beiden älteren Kinder waren sie angereist, aber sonst traf man sich kaum. Man reiste nicht so viel damals.
Читать дальше