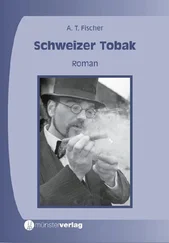Andere hätten sich einfach wie er so gut wie möglich eingerichtet und seien dabei gar erfolgreich geworden, wie etwa der Jurist Thomas Richter, sein Berater für schwierige Verträge, oder hätten sich durchgewurstelt oder durchgekämpft wie sein einstiger Genosse Kurt Streit, ein Zeitungsschreiber. In Zürich habe Letzterer Prügel mit Kopfverletzungen bezogen. Danach begann er für die Achstädter Rote Zeitung unermüdlich nach kapitalistischen Sünden zu suchen und kam dabei, als Beispiel unter vielen, den nicht bezahlten Beiträgen für die Pensionskasse der Aasbachschen Spinnereiarbeiter auf die Spur.
«Er hat damit die Rente meines Vaters gerettet», erklärte Rolf und fuhr fort: «Wenige Jahre später, der rote Kurt, wie wir ihn nannten, hatte es inzwischen zum Stellvertreter seines Chefs gebracht, musste das rote Blatt sein Erscheinen einstellen. Da begann der Eiferer ein Buch über den Faschismus in der Schweiz zu schreiben, welches allerdings nie gedruckt wurde. Seinetwegen habe ich die Festplatte und damit die Tagebücher einer zwar gewendeten, aber vormals strammen Hitler-Anhängerin kopiert. Das war eine unverzeihliche Dummheit mit für mich beinahe traumatischen Folgen. Die ehemalige Deutsche war die Mutter meiner Freundin. Mehr den wirtschaftlichen Zwängen, denen sich ein Familienvater gelegentlich ausgesetzt sieht, als seiner inneren Stimme gehorchend, wurde Kurt danach zum umtriebigen Redaktor eines Landanzeigers, Träger für Inserate mit bescheidenem redaktionellem Umfeld und dem stramm rechtsbürgerlichen Hintergrund der Achstädter Tageszeitung. Kurts Sozialismus existierte nur noch in seinem Reptiliengehirn. Endgültig erfolgreich wurde er, als ein bislang kleines, aber topfittes Regionalblatt den durch überdimensionierte Investitionen überschuldeten Zeitungsverlag kappte und die Redaktionen der Blätter straffte. Die Zeit der Medienkonzentration war angebrochen. Die Zeitung wurde eine Zeitung für alle und Kurt zum unermüdlichen Schreiber für alle. Später soll er in eine PR-Agentur für nichtstaatliche Organisationen gewechselt haben. Vor einem Jahr ist der Mann 55-jährig gestorben, angeblich an einem Krebsleiden.»
Rolf meinte, manchmal schlage sein Herz noch immer links, vor allem, wenn es um ein wenig mehr Gerechtigkeit gehe. Aber mit den Menschen, die sich lauthals als Sozialisten gebärdeten und in komfortablen Amtsstuben ihre ruhige Kugel schöben, hätte er mehr und mehr Mühe und dies nicht erst, seit der Koloss im Osten zusammengebrochen sei. Kurts früherer Eifer sei ihm manchmal beinahe lästig gewesen.
Seit über 20 Jahren besitze und führe er sein kleines Unternehmen und wisse daher, wie schwierig es sei, sich im Wettbewerb zu bewähren und erfolgreich durchzusetzen. Dieser meistens enorme und unermüdliche Einsatz verdiene Anerkennung und materielle Vorteile. Andererseits erscheine ihm ein kapitalistisches Haudegen- und Raubrittertum, wie es die Amerikaner vorlebten und der ganzen Welt aufzupfropfen versuchten, noch immer nicht nur dumm, sondern auch sehr gefährlich. Er glaube nicht an das Ende des Kampfes der Unterprivilegierten.
«Wenn die Besitzenden weiter raffen wie gegenwärtig, wird ‹Die Internationale› früher oder später wieder in Mode kommen», glaubte Rolf zu wissen.
Einerseits fühlte ich mich von seiner Vergangenheit und von seinem noch immer vorhandenen Ehrgeiz und Fleiss beeindruckt, andererseits – und dies bei weitem nicht zum ersten Mal – aber auch etwas beschämt über meine eigene banale Geschichte und meine etwas abgehobene Untätigkeit oder gar Faulheit in den paar Jahren als Rentner.
Um meine leichte Verlegenheit zu vertuschen, versuchte ich, mich mit meiner einstigen Arbeitswelt im Bereich von Werbung und Public Relations wichtig zu machen und von meinen eigenen kleinen Ausflügen ins weltweite Netz und seine virtuellen Räume zu erzählen.
Nur scheinbar beiläufig erwähnte ich meine Versuche, Geschichten aus meiner Vergangenheit und meiner Mitwelt zu schreiben. Es gelang mir sogar, zu einem kleinen Vortrag auszuholen: «Ich glaube an die therapeutische Wirkung des Schreibens, eines absichtslosen Schreibens ohne irgendwelchen literarischen oder künstlerischen Ehrgeiz, nur um so etwas wie Klarheit, Wahrheit, Ordnung, Übersicht in mir selbst zu finden, schmerzliche Bilder auszublenden, gute Tage zurückzuholen, Inventur zu machen, Bilanz zu ziehen und mich dabei nicht um Spannung oder schwierige Zeitsprünge, Gewichtung der Sätze, Rechtschreibung und Interpunktion, nicht um die Ärmlichkeit des Vokabulars, um die Ausgefeiltheit geistreicher Dialoge, die es im Alltag ohnehin kaum gibt, zu kümmern. Nicht einmal die faktische Wahrheit soll dominieren, sondern nur die erfühlte», erklärte ich dazu.
Für ihn erstaunlich sei, dass ihm mehr und mehr Kunden und andere Leute die ihm durch seine Arbeit begegneten, erzählten, sie versuchten Geschichten, Erlebnisse oder gar Einsichten aus ihrem Leben auf dem PC aufzuschreiben. Vielleicht sei der Computer für viele so etwas wie eine einsame Insel, auf der man sich ausschreien, ganz einfach entspannen oder sich mit sich selbst auseinandersetzen könne, ohne Spuren zu hinterlassen. Vieles würden diese Menschen kaum je einem Papier überlassen und zudem zwinge das Papier zu einer unwillkommenen Disziplin oder Denkarbeit. Der Raum im PC hingegen lade geradezu ein, frisch von der Leber weg zu schreiben. Eine Ordnung lasse sich im Nachhinein errichten oder eben nicht. Zudem lasse sich alles mit einem einfachen Klick l öschen, abfallfrei. Im Zweifel war alles nur virtuell und leer, sagte Rolf.
Gegenwärtig sei ich am Versuch, die Erinnerungen an meine Eltern zu Papier zu bringen, berichtete ich. Am meisten aber beschäftige mich das Scheitern meiner eigenen Ehe. Ich sei in einer intakten katholischen Familie aufgewachsen und hätte alles mitbekommen, was es brauche, um eine harmonische Ehe zu führen. Und doch seien meine Frau und ich daran gescheitert, schon zu einer Zeit, als im Schnitt nur fünf oder sechs von hundert Ehen zerbrachen. Wir hätten uns dabei allerdings wie erwachsene Menschen benommen, alles vernünftig beredet und uns mit Anstand und gegenseitigem Respekt getrennt, liess ich gegenüber Rolf immer wieder durchblicken. Inzwischen werde jede dritte Ehe geschieden und dies ohne die Brüche der sogenannten festen Partnerschaften mitzuzählen.
«Alles in allem trennt sich jedes zweite Paar: Eins, zwei, eins, zwei … und hinter jedem Bruch steht eine mehr oder weniger traurige Geschichte. Jede Trennung, unabhängig vom Trauschein, ist schmerzhaft, hinterlässt Wunden und im besten Fall verheilte Narben», resümierte ich und fügte an, am meisten hätten die Kinder darunter zu leiden, obwohl von diesen Wunden im Alltag kaum die Rede sei. Davon wären vermutlich auch meine Kinder nicht verschont geblieben, obwohl deren Mutter und ich alles so schonend wie möglich durchgezogen hätten.
Rolf Schneider, mit dem ich inzwischen längst auf Du und Du stand, zeigte sich erstaunlich offen gegenüber diesem Thema. Er meinte, sein Vorteil sei gewesen, sich nie zu verheiraten und keine eigenen Kinder zu haben.
Das gemeinsame Leben seiner Eltern war aus seiner Sicht ein Albtraum gewesen. Seine Mutter hätte ein besseres Leben verdient gehabt. Was Norbert – so nannte Rolf seinen Vater beinahe ausnahmslos – ihr, ihm und seinen Schwestern zugemutet habe, sei abscheulich gewesen, und ihn, Rolf, habe durch das ganze Leben als Erwachsener die Angst verfolgt, so zu werden wie Norbert. Dabei hätte er als Kind diesen Mann bewundert, weil er als Aufseher über viele Frauen in der Sulzacher Spinnerei so mächtig gewesen war und Norbert über die Spinnerei und Autos so viel wusste. Rückblickend aber erscheine ihm Norberts Leben, auch als Aufseher in der Spinnerei, noch jetzt als ein Knäuel offener Fragen.
Rolf fand, in den letzten 50 Jahren hätten in unseren westlichen Gesellschaften Millionen von Menschen ähnliche Schwierigkeiten durchgestanden, oft nur in Angst und Schrecken überlebt und notgedrungen neue Wege des Zusammenlebens finden müssen.
Читать дальше