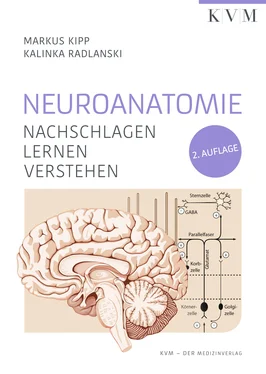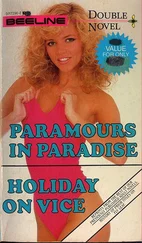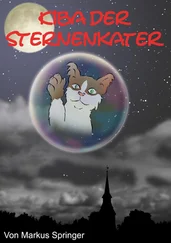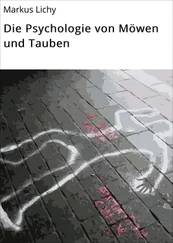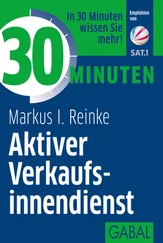Mesencephalon – das Mittelhirn
Das Mittelhirn ( Mesencephalon) liegt zwischen Pons und Zwischenhirn (Diencephalon). Es lässt sich von vorne nach hinten in drei Anteile gliedern. Von vorne sichtbar sind die Hirnschenkel ( Crura cerebri). Sie beinhalten vor allem die zu Pons, Medulla oblongata und Rückenmark absteigenden Bahnen der Großhirnrinde. Weiter nach hinten schließt sich den Hirnschenkeln das Tegmentum (Haube) an. Im Tegmentum mesencephaliliegen viele Kerne, die im Dienste der Motorik stehen. Beispiele sind der Nucleus ruber(roter Kern) und die Substantia nigra(schwarze Substanz). Letztere ist bekannt geworden durch ihre zentrale Relevanz bei der Entstehung des M. Parkinson. Darüber hinaus ziehen wichtige aufsteigende Fasersysteme durch diesen Teil des Mittelhirns, so zum Beispiel der Lemniscus medialis, der sensible Informationen aus dem Rückenmark in Richtung Thalamus und von dort weiter zum sensiblen Kortex (Gyrus postcentralis) leitet. Dorsal, also nach hinten, lagert sich dem Tegmentum des Mittelhirns eine „Wasserleitung“ an, der Aquaeductus mesencephali(Stern in Abb. 2.6). Diese Wasserleitung verbindet den dritten mit dem vierten Ventrikel des inneren Liquorsystems, einem mit Nervenwasser gefüllten Hohlraumsystems des Zentralnervensystems. Mit dem Aufbau dieses Liquorsystems befassen wir uns in Kapitel 4dieses Lehrbuches. Noch vor dem Aquaeductus mesencephali liegen im Tegmentum des Mittelhirns die Kerngebiete des dritten Hirnnerven sowie ein Teil des Kernes des fünften Hirnnerven.
Blickt man von hinten auf das Mittelhirn, zeigen sich zwei mal zwei Hügel, zusammengefasst als Vierhügelplatte (Synonym: Lamina tecti oder auch Lamina quadrigemina). Sie bilden das Dach, das Tectumdes Mittelhirns. Die oberen Hügel, die Colliculi superiores, erhalten über Sehnerv und Sehtrakt wichtige visuelle Informationen. Dabei geht es primär um Informationen über sich rasch ändernde Reize – also um Bewegung. Das könnte ein fahrendes Auto sein, dem wir mit den Augen folgen oder ein Ball, der auf unser Gesicht zufliegt, woraufhin wir reflexartig die Augen schließen. Entsprechend äußern sich auch die Ausfälle bei Schädigungen des oberen Hügels: Reflektorische Augenbewegungen sind dann erschwert, wobei weiterhin sämtliche optische Reize wahrgenommen und verarbeitet werden können. Die Colliculi inferiores, die unteren Hügel, dienen als Umschaltstelle für die meisten Fasern der Hörbahn. Da die unteren Hügel auch direkt Informationen an die oberen senden, wird hier eine reflexhafte Integration beider Sinnesmodalitäten möglich – wir blicken automatisch in die Richtung eines lauten Geräusches.
Merke
Oft haben Studenten Probleme sich zu merken, welche der Hügel im visuellen und welche im akustischen System eingebettet sind. Schauen Sie doch einfach ihren Sitznachbarn an. Die Augen stehen höher als die Ohren, demnach obere Hügel = visuelles System, untere Hügel = auditorisches System.
Truncus cerebri – der Hirnstamm
Mit der Medulla oblongata, dem Pons und dem Mesencephalon haben wir bereits drei wichtige Strukturen des Gehirns kennengelernt. Vergleicht man das Gehirn mit einem Baum, so würden diese drei Strukturen am ehesten dem Stamm des Baumes entsprechen, weiter oben gelegene Abschnitte, vor allem das Großhirn, entsprächen sodann den Ästen und den Blättern. Medulla oblongata, Pons und Mesencephalon werden deswegen in ihrer Gesamtheit auch als Hirnstamm ( Truncus cerebri; Truncus encephali) bezeichnet. Entwicklungsgeschichtlich ist der Hirnstamm ein recht alter Teil des Gehirns, und so fallen die Unterschiede zwischen Mensch und Tier vergleichsweise gering aus. Oben schließen sich Zwischen- und Großhirn, nach hinten das Kleinhirn an.*
Cerebellum – das Kleinhirn
Hinten im Schädel, direkt unterhalb des Telencephalons und hinter dem Hirnstamm liegt das Kleinhirn ( Cerebellum). Von außen sind seine beiden Hälften gut zu erkennen, die – wie die Hälften des Großhirns – als Hemisphären bezeichnet werden. Das Kleinhirn ist mit dem Hirnstamm auf jeder Seite mit je drei Kleinhirnstielen (Pedunculus cerebellaris inferior, medius und superior) verbunden, durch welche wichtige Faserverbindungen verlaufen (nur schwer zu sehen in Abb. 2.6und 2.7). Nach oben und unten spannen sich zum Hirnstamm zwei dünne Strukturen aus, das obere und untere Marksegel (Velum medullare superius und inferius; angedeutet als gestrichelte Linie in 2.7). Diese sind im medio-sagittalem Schnitt besonders gut zu sehen.
Abb. 2.7
Cerebellum mit Hirnstamm, median halbiert
Alle Hirnhäute entfernt
1Lamina quadrigemina, Mesencephalon
2Substantia nigra, Mesencephalon
3Vierter Ventrikel
4Pons
5Folia cerebelli
6Plexus choroideus des vierten Ventrikels
7Medulla oblongata
Zwischen Kleinhirn und Hirnstamm liegt ein weiterer mit Liquor gefüllter Hohlraum des Gehirns, der vierte Ventrikel. Dessen vordere Begrenzung wird auch als Rautengrube (Fossa rhomboidea) bezeichnet. Strukturen, die den vierten Ventrikel mit seiner Rautengrube umgeben, nennt man Rhombencephalon(griech. „Rautenhirn“). Das Rhombencephalon setzt sich demnach aus Cerebellum, Pons und Medulla oblongata zusammen.
Obwohl das Kleinhirn nur etwa ein Sechstel vom Volumen des Telencephalons besitzt, beherbergt es weit mehr Neurone als das Großhirn. Um derart viele Nervenzellen auf so engem Raum unterbringen zu können, ist die Kleinhirnrinde, der äußere Mantel des Kleinhirns, stark gefaltet. Die dadurch entstehenden horizontalen Fältchen werden als Blätter ( Folia cerebelli) bezeichnet. Wie wir bereits gesehen haben, weist auch das Großhirn solche Falten auf, nur werden sie dort Gyri genannt. Zerteilt man eine der Kleinhirnhemisphären längs (so wie in unserem medio-sagittalen Schnitt), präsentiert sich das Kleinhirn wie die Form eines Baumes. Die Anatomen bezeichnen dies als Lebensbaum, als Arbor vitae.
Aber was macht das Kleinhirn eigentlich? Als 1917 der englische Neurologe Gordon Holmes (1876–1965) Soldaten mit Kleinhirnverletzungen untersuchte, erkannte er: „Das Kleinhirn kann als ein Organ gesehen werden, das Bewegung unterstützt.“ Tatsächlich bestätigen bildgebende Verfahren mittlerweile, dass das Kleinhirn Bewegungen koordiniert und moduliert: Ob man die Kaffeetasse anhebt, Klavier oder Fußball spielt – das Kleinhirn greift überall modulierend ein. Zudem wird dem Kleinhirn neuerdings auch eine Rolle bei zahlreichen höheren kognitiven Prozessen zugeschrieben. Wir sehen, der Name und das geringe Volumen täuschen: Das Kleinhirn ist dem Großhirn in der Komplexität seiner Aufgaben und der Anzahl seiner Neuronen keineswegs unterlegen. 6
Diencephalon – das Zwischenhirn
Das Diencephalonschließt sich nach oben dem Mesencephalon an. Es enthält unter anderem Umschaltstationen für aufsteigende sensible und motorische Bahnen sowie regulatorische Zentren für das vegetative und endokrine System. Im medio-sagittalen Schnitt kann man vom Diencephalon nur einige wenige Strukturen erkennen. Überhaupt ist es recht komplex aufgebaut und bereitet den Studierenden regelmäßig so seine lieben Probleme. Keine Angst, wir werden es im entsprechenden Kapitel detailliert besprechen. Hier beschränken wir uns auf einige allgemeine Anmerkungen zum Zwischenhirn: Das Diencephalon umschließt auf beiden Seiten den dritten Ventrikel, der genauso wie der vierte Ventrikel einen Teil der inneren Liquorräume darstellt. Bei der medio-sagittalen Schnittführung wird der dritte Ventrikel quasi halbiert, wir schauen deswegen in den Abbildungen 2.6 und 2.8 in das Lumen des dritten Ventrikels hinein. Viele der um den dritten Ventrikel liegenden Strukturen gehören zum Diencephalon.
Читать дальше