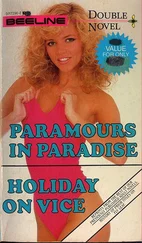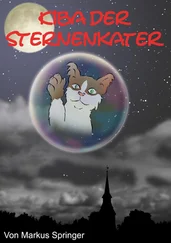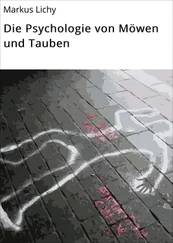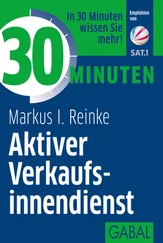Klinik
Klinik
Als Reizdarmsyndrom, oder kurz Reizdarm, bezeichnet man eine relativ häufige Funktionsstörung des Darms. Die Betroffenen – etwa doppelt so viele Frauen wie Männer – leiden unter Darmbeschwerden, für die sich trotz gründlicher ärztlicher Untersuchungen keine körperliche Ursache findet. Früher wurde der Reizdarm daher schlichtweg als psychisch bedingt angesehen. Heute weiß man, dass viele Faktoren an seiner Entstehung beteiligt sein können. Zu den Symptomen eines Reizdarms zählen unter anderem wiederkehrende Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung sowie Blähungen. Inwiefern dem Reizdarmsyndrom eine fehlerhafte Kommunikation zwischen Gehirn und enterischem Nervensystem zugrunde liegt, wird momentan untersucht. 5
Afferenzen und Efferenzen
Eine weitere Betrachtungsweise des Nervensystems bezieht sich darauf, ob Informationen dem Zentralnervensystem zugeleitet werden oder ob Informationen vom Zentralnervensystem in die Peripherie geleitet werden. Informationen, die vom Zentralnervensystem in die Peripherie ziehen, nennt man Efferenzen ( Abb. 2.3, blau hervorgehoben). Informationen, die von der Peripherie in das Zentralnervensystem geleitet werden, nennt man Afferenzen ( Abb. 2.3, rot hervorgehoben). Auf das somatische Nervensystem bezogen bedeutet das: Beim Ausführen einer Bewegung werden Teile der Großhirnrinde, u. a. der Gyrus praecentralis, aktiv und leiten über das Rückenmark die motorischen Impulse in die Peripherie zum jeweiligen Muskel. Da diese Information ihren Weg aus dem Zentralnervensystem in die Peripherie nimmt, handelt es sich um eine Somato-Efferenz. Bei der Leitung eines sensiblen Impulses (zum Beispiel Schmerzen) entsteht das Signal in der Peripherie und wird dem Gehirn über Spinalnerven, Rückenmark und weitere, an dieser Stelle nicht genauer bezeichnete Bahnen der Großhirnrinde, dem Gyrus postcentralis, zugeleitet. Da diese Information ihren Weg aus der Peripherie in das Zentralnervensystem nimmt, handelt es sich um eine Somato-Afferenz.
Merke
Afferenz = ankommend
Efferenz = w egführend
Ganz ähnlich wie im somatischen Nervensystem lassen sich auch im vegetativen Nervensystem Afferenzen und Efferenzen voneinander abgrenzen. Informationen aus dem Zentralnervensystem zur Steigerung der Herzaktivität, Verdauungsaktivität oder der Atmung sind demnach Viszero-Efferenzen, Informationen über den Sauerstoffpartialdruck, den Blutdruck oder aber der Magenaktivität nennt man hingegen Viszero-Afferenzen. Wie wir später noch sehen werden, wird die motorische Komponente des vegetativen Nervensystems noch einmal in den sogenannten Sympathikusund den Parasympathikusuntergliedert. Vereinfacht kann man sich vorstellen, dass der Sympathikus im Wesentlichen alle Funktionen, die bei Gefahrensituationen vonnöten sind, reguliert (fight-or-flight; sogenannte ergotrope Wirkung). Der Parasympathikus beeinflusst als funktioneller Gegenspieler des Sympathikus im Gegensatz dazu die Verdauung. Er wird deswegen auch als „Ruhenerv“ bezeichnet, da er dem Stoffwechsel, der Erholung und dem Aufbau körpereigener Reserven dient (rest-and-digest; sogenannte trophotrope Wirkung).
Zusammenfassendes Funktionsprinzip des Nervensystems
Wir haben bisher das Nervensystem histologisch in graue und weiße Substanz unterteilt, topographisch in peripheres und zentrales Nervensystem, funktionell in somatische und vegetative Komponenten sowie bezogen auf die Leitung der Aktionspotenziale in afferente und efferente Anteile. Viele der bisher angesprochenen Bestandteile des Nervensystems lassen sich mit der Organisationseinheit und der Funktionsweise eines großen Krankenhauses vergleichen. Vor dem operativen Eingriff bei einem Patienten gibt es eine Vielzahl von Konferenzen und Besprechungen. Verschiedene Befunde wie Blutwerte, Ultraschall und MRT-Ergebnisse werden verglichen und in die Entscheidung für oder gegen einen operativen Eingriff einbezogen. Diese Entscheidungsfindung ist oft ein sehr komplizierter Prozess, Pros und Contras müssen mitunter genau gegeneinander abgewogen werden. In der Regel sind verschiedene Fachdisziplinen an einem solchen Prozess beteiligt. Nachdem eine Entscheidung zum operativen Eingriff getroffen wurde, wird dieser vom Chirurgen durchgeführt. Oft ist die Entscheidung für oder gegen eine Operation weitaus komplizierter und langwieriger als der eigentliche operative Eingriff selbst. Ganz ähnlich funktioniert auch das Nervensystem: Bewegungsmuster werden beispielsweise, wie wir später in diesem Lehrbuch noch sehen werden, im Zentralnervensystem entworfen und von verschiedenen Gehirnregionen auf ihre Sinnigkeit und Genauigkeit hin moduliert. Sehr viele verschiedene Strukturen, wie etwa das Kleinhirn oder die Basalganglien, sind an solch einer recht komplexen Modulation von Bewegungsimpulsen beteiligt. Die Funktion des peripheren Nervensystems ist demgegenüber relativ einfach zu verstehen: Entworfene und angeglichene Programme werden dem Erfolgsorgan (in diesem Fall der Skelettmuskulatur) nur noch übermittelt.
Die richtige Entscheidung für oder gegen eine Operation bedarf der kontinuierlichen Rückmeldung über den Zustand des Patienten. Hat man sich zum Beispiel für eine Operation entschlossen, der Patient erleidet jedoch einen Kreislaufkollaps, würde die Operation sogar im letzten Moment noch abgesagt und die Entscheidung neu überdacht werden. Auch das Nervensystem benötigt zu einer regelhaften Funktion die kontinuierliche Rückmeldung aus der Peripherie. Vergleichbar dazu werden bei einer Bewegungsausführung dem Zentralnervensystem kontinuierlich durch periphere Rezeptororgane Informationen über die Muskelspannung sowie die Lage und Stellung der Gelenke zugeleitet. Diese Rückmeldung wird in die Modulation von Bewegungsimpulsen quasi eingearbeitet.
In diesem Zusammenhang stellt sich eine nicht ganz einfache Frage: Wer ist nun wichtiger – das somatische oder das vegetative Nervensystem? Vergleichen wir hier wieder mit der Organisationseinheit eines Krankenhauses. Dort gibt es verschiedene klinische Abteilungen wie etwa die Chirurgie, die Innere Medizin, oder aber die Radiologie. Zweifelsohne ist das harmonische Zusammenspiel dieser einzelnen klinischen Abteilungen unabdingbar für die erfolgreiche Behandlung eines Patienten. Wenn in der Chirurgie ein Fehler passiert, ist dieser mitunter schnell offensichtlich und wird als Malus wahrgenommen. Auch eine falsche Behandlung der Internisten kann oft direkt vom Patienten oder seinen Angehörigen wahrgenommen werden. Leistungen dieser Fachdisziplinen werden einem tagtäglich bewusst, sie können demnach als somatischer Teil des Krankenhauses angesehen werden. Es arbeiten jedoch viele verschiedene Organisationseinheiten im Hintergrund, ohne dass deren Leistung direkt wahrgenommen wird. Vertreter solcher Organisationseinheiten sind zum Beispiel der Bettendienst, die Küche oder die Techniker, die für die Instandhaltung des Krankenhauses verantwortlich sind. Auch wenn deren Aufgaben einem nicht immer direkt bewusst werden, so werden Sie sicher zustimmen, dass bei einer Fehlfunktion dieser Organisationseinheiten eine regelhafte Behandlung der Patienten nicht mehr möglich wäre. Der Bettendienst, das Küchenpersonal, die Techniker – all diese Abteilungen können als vegetativer Teil des Krankenhauses angesehen werden. Entscheiden Sie selber, ob nun das somatische oder das vegetative Nervensystem wichtiger für unser Leben ist. Ich denke, auch Ihnen wird eine Entscheidung schwer fallen.
Topographische Betrachtung des Nervensystems
Um alle Anteile an dem aus der knöchernen Schädelkalotte entnommenen Gehirn betrachten zu können, muss man es drehen und wenden. Der Einfachheit halber werden in der makroskopischen Anatomie verschiedene Blickwinkel (Ansichten) auf das Gehirn definiert. Ziel dieses Kapitels ist es, dass Sie einen topographischen und funktionellen Überblick hinsichtlich der Komponenten, vor allem des Zentralnervensystems, erhalten. Später werden wir, wo nötig, genauer auf die verschiedenen Strukturen eingehen.
Читать дальше
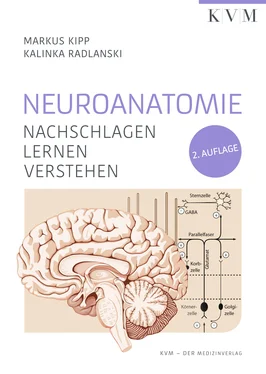
 Klinik
Klinik