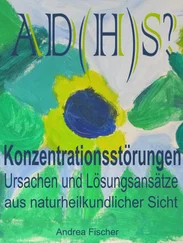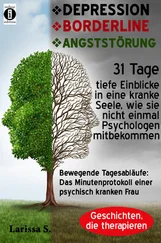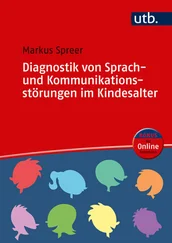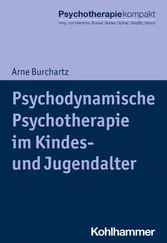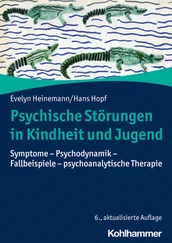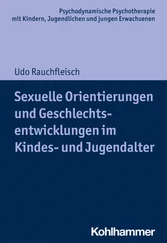In einer nicht klinischen Stichprobe (Wright et al., 2010) berichteten Kinder zwischen 8 und 11 Jahren über Symptome sozialer Angst und Depression sowie über Coping-Strategien zu zwei Messzeitpunkten. Die Copingstrategien wurden bezogen auf einen sozialen Stressor erhoben (»Stell dir vor, ein anderes Kind wäre gemein zu dir und würde dich beschimpfen oder schlagen und treten. Was würdest du tun?«). Erhöhte depressive Symptome zeigten sich zusammenhängend mit weniger Problemlösestrategien, weniger Suche nach sozialer Unterstützung, weniger Ablenkung und erhöhter Externalisierung (z. B. Schreien oder Werfen von Gegenständen). Soziale Angst hingegen war assoziiert mit erhöhter Suche nach sozialer Unterstützung, Ablenkung und Internalisierung (z. B. Sorgen oder Selbstmitleid). Soziale Angst und depressive Symptome sagten negative Copingstrategien zum zweiten Messzeitpunkt neun Monate später vorher. Individuelle Copingstrategien konnten jedoch spätere Depression und/oder Angststörung nicht vorhersagen. In der klinischen Anwendung sollten somit Copingstrategien genau exploriert werden, da diese transdiagnostisch abweichen können.
Auch wenn Suchterkrankungen im Kindesalter noch keine größere Rolle spielen, werden diese bei unbehandelter Sozialer Angststörung im Jugend- und Erwachsenenalter höchst relevant: Im (jungen) Erwachsenenalter folgt der Sozialen Angststörung häufig ein missbräuchlicher Konsum von Alkohol (19–28 %, Ham, Bonin & Hope, 2007). Eine große epidemiologische Studie aus den USA (Grant et al., 2005) berichtet, dass mit einer Sozialen Angststörung (Lebenszeit) in 48,2 % der Fälle eine Alkoholabhängigkeit, in 22,3 % Drogenmissbrauch und in 33 % eine Nikotinabhängigkeit einhergeht. Im Verlauf von Jugend und frühem Erwachsenenalter mehren sich neue soziale Situationen, die es zu meistern gilt; Alkohol wird dabei als einfach verfügbare Methode gesehen, Gefühle von Angst zu bewältigen (Ham et al., 2007). Obgleich diese Argumentation logisch einleuchtend erscheint, deuten andere Studien darauf hin, dass erhöhte soziale Angst mit geringerem Alkoholkonsum einhergeht (Lewis et al., 2008) und sozial ängstliche Personen nach Alkoholkonsum z. B. negativere Konsequenzen erleben. Somit stellt die Soziale Angststörung wahrscheinlich einen Risikofaktor für einen schädlichen Umgang mit Substanzen dar.
Merke: Unterschiede Suchterkrankungen und Soziale Angststörung
Bei einer reinen Abhängigkeitsstörung wird die Substanz nicht nur in sozialen Situationen konsumiert.
3.2 Differenzialdiagnostik
Direkt zu Beginn der Diagnostik stellt sich die Frage der differenzialdiagnostischen Abklärung. Gerade weil eine hohe Komorbidität besteht und einzelne Symptome zu verschiedenen (Angst-)Erkrankungen gehören, ist eine genaue Anamnese der Symptomatik sinnvoll. Berichtet ein Kind beispielsweise insbesondere die Angst vor dem Schulbesuch und die Vermeidung dessen, wäre basierend auf ICD-10 (WHO, 1994) und DSM-5 (APA, 2013) die Spezifische Phobie (Vermeidung der Schule aus Angst vor Prüfungen), eine Emotionale Störung mit Trennungsängstlichkeit (Vermeidung der Schule aus Angst vor Trennung von den Eltern), eine Generalisierte Angststörung (GAS; Vermeidung der Schule aufgrund verschiedener Ängste, z. B. soziale Ängste, Leistungsängste etc.) oder auch soziale Schwierigkeiten (Vermeidung der Schule z. B. aufgrund von Bullying) abzuklären. Generell gilt, dass die Diagnosen selbstverständlich auch parallel vorliegen und sich gegenseitig negativ beeinflussen können ( Kap. 3.1, Komorbidität).
3.2.1 Generalisierte Angststörung
Die Generalisierte Angststörung umfasst anhaltende Ängste, Anspannung, Befürchtungen und Sorgen in Bezug auf alltägliche Ereignisse in verschiedenen Bereichen (z. B. Schule, Familie, Weltgeschehen) mit einer vegetativen Angstreaktion über einen Zeitraum von sechs Monaten. Im Rahmen der Generalisierten Angststörung treten neben Sorgen im Alltag (z. B. Verspätungen), dem Weltgeschehen, dem eigenen Wohlbefinden und der Gesundheit der Familie ebenfalls häufig Ängste in sozialen Situationen und im Leistungsbereich auf, sodass eine genaue diagnostische Abklärung notwendig ist. Die Generalisierte Angststörung umfasst jedoch auch starke Ängste in anderen Bereichen, die eher als »frei flottierend« gelten, d. h. die Ängste wechseln sprunghaft zwischen verschiedenen Inhaltsbereichen (WHO, 1994). Die Generalisierte Angststörung beinhaltet zudem diagnostisch keine explizite Vermeidungskomponente, d. h. Situationen werden dennoch aufgesucht, auch wenn sie angstbesetzt sind. Ähnlichkeiten bestehen im kognitiven Charakter der Generalisierten und der Sozialen Angststörung: Patient*innen tendieren jeweils zum Katastrophisieren und zur Erwartung des »worst case« in einer Situation. Patient*innen mit Generalisierter Angststörung springen dabei oft von einer kleinen Sorge direkt zu einer Katastrophenannahme im Sinne einer Sorgenkette ( Abb. 3.1).
Abb. 3.1: Sorgenkette inklusive möglicher Zwischenschritte.
Patient*innen mit einer Sozialen Angststörung bleiben dabei eher im Hier und Jetzt und nehmen für die konkrete Situation das Schlimmste an (z. B. »Ich werde mich beim Referat versprechen, alle werden mich auslachen«).
Obgleich soziale und generalisierte Ängste häufig parallel vorliegen ( Kap. 3.1.1), ist nach ICD-10 keine gemeinsame Vergabe der Störungsbilder möglich. Hier sollte abgewogen werden, ob die soziale Angst die zentrale Angst ist und andere Ängste eher passager auftreten.
Hinweise und Fragen zur Differenzialdiagnostik der Generalisierten Angststörung
Bei der Abklärung der Differenzialdiagnostik sind folgende Fragen relevant (wenn Antwort bejaht, Diagnose der Generalisierten Angststörung andenken):
1. Liegen weitere ausgeprägte Ängste vor? Sind diese ähnlich stark wie die sozialen Ängste?
Bei mehreren, ähnlich stark ausgeprägte Ängsten, die eher »frei flottierend« berichtet werden (z. B. eine Zeit lang Angst vor Prüfungen, abends immer wieder Angst, dass den Eltern etwas passiert, auf Berichte in den Medien hin Angst vor Kriegen oder Naturkatastrophen etc.).
2. Wird eine ausgeprägte körperliche Angstreaktion berichtet?
Mindestens vier vegetative, atembezogene, psychische, Anspannungs- und/oder allgemeine Symptome müssen für die Diagnose einer Generalisierten Angststörung nach ICD-10 vorliegen. Körperliche Symptome sind in der Regel stärker ausgeprägt (Szafranski et al., 2014). Zur besseren differenzialdiagnostischen Abklärung innerhalb der Angststörungen ist ein strukturiertes klinisches Interview (  Kap. 4) sinnvoll.
Kap. 4) sinnvoll.
3.2.2 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen: Autismus-Spektrum-Störungen
Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) wurden im Rahmen der Neuentwicklung des DSM-5 (APA, 2013) überarbeitet, sodass im Folgenden von dieser Klassifikation statt der des ICD-10 (WHO, 1994) ausgegangen wird. Für die ICD-11 wird eine ähnliche Überarbeitung erwartet. Die Symptomatik der ASS zeichnet sich aus durch qualitative Einschränkungen der sozialen Interaktion und Kommunikation (z. B. keine wechselseitige Kommunikation, eingeschränkte Gestik und Mimik, wenig Blickkontakt) sowie restriktive, repetitive Verhaltensweisen, Interessen oder Aktivitäten (z. B. Händeflattern, Echolalie, starke Bindung an Objekte, Spezialinteressen). Die Symptome bestehen in der Regel bereits seit der frühen Kindheit und gehen bei höherem Schweregrad meist mit einer (teilweise starken) intellektuellen Beeinträchtigung einher (APA, 2013). In der Differenzialdiagnostik können insbesondere Schwierigkeiten in der Abgrenzung der Sozialen Angststörung von der ASS vom Schweregrad 1 (ehemals hochfunktional) entstehen. Bei geringerem Schweregrad liegt die kognitive Gesamtbegabung meist im normalen Bereich und Kinder imponieren eher mit Auffälligkeiten in der Interaktion, Kommunikation und speziellen Interessen. Kinder mit Sozialer Angststörung wirken jedoch ebenfalls im sozialen Kontakt oft ungeschickt, halten wenig Blickkontakt und zeigen scheinbar wenig Interesse am Gegenüber zu haben (Towbin, Pradella, Gorrindo, Pine & Leibenluft, 2005). Differenzialdiagnostisch muss daher geprüft werden, ob Spezialinteressen vorliegen, wie lange die Schwierigkeiten schon bestehen sowie ob generell ein Kompetenzdefizit in der sozialen Interaktion vorliegt. Kinder mit Sozialer Angststörung zeigen im Kontakt in der Regel eher ein Performanzdefizit, d. h. in vertrauten Kontakten verhalten sie sich durchaus sozial kompetent. Beachtet werden sollte jedoch, dass auch Kinder mit ASS häufig von sozialen Ängsten berichten (White, Oswald, Ollendick & Scahill, 2009), da sie wissen, dass sie »anders« wirken und häufig negatives Feedback erhalten. Es muss somit geklärt werden, ob gegebenenfalls beide Störungsbilder vorliegen.
Читать дальше
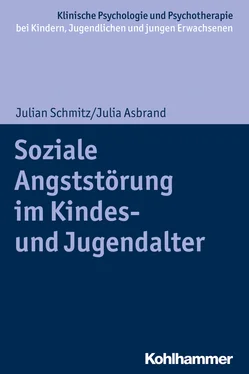
 Kap. 4) sinnvoll.
Kap. 4) sinnvoll.