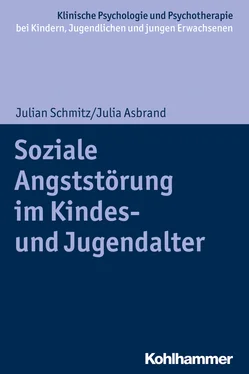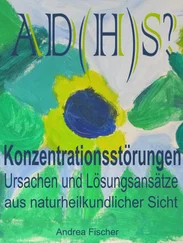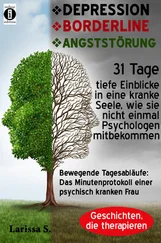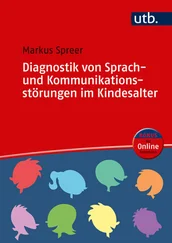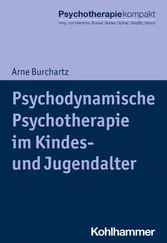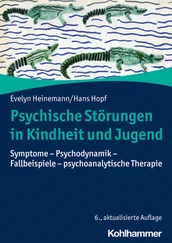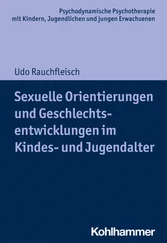3.1.1 Andere Angststörungen
Gerade da andere Angststörungen besonders häufig komorbid zur Sozialen Angststörung vorliegen (Szafranski et al., 2014), ist zunächst genau zu klären, ob tatsächlich eine weitere Angststörung vorliegt, oder ob die Sozialen Ängste im Rahmen einer anderen Diagnose besser erfasst werden. So treten z. B. im Rahmen der Generalisierten Angststörung meist auch soziale Ängste auf ( Kap. 3.2.1). Obgleich gewisse Faktoren in der Ätiologie verschiedener Angststörungen sicher ähnlich sind (z. B. zurückhaltendes Temperament, negative Lernerfahrungen), ist für die Therapieplanung eine differenzierte Erfassung der Symptomatik und möglicher Komorbiditäten essenziell.
Die häufigste Komorbidität der Sozialen Angststörung im Bereich der Angststörungen stellt die Spezifische Phobie dar (ICD-10: F40.1; 10 %, Beidel, Turner & Morris, 1999), welche eine ausgeprägte Angst vor spezifischen Objekten oder Situationen umfasst. Ebenfalls sehr häufig tritt eine komorbide Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters (ICD: F93.0) auf (6 %, Beidel et al., 1999).
Nach ICD-10 ist eine gleichzeitige Kodierung der Sozialen Angststörung und der Generalisierten Angststörung nicht möglich (F41.1; WHO, 1994). Nach DSM-5 ist die parallele Diagnosestellung möglich, was dem Fakt Rechnung trägt, dass im Alltag häufig beide Störungsbilder parallel auftreten. Dies spiegelt sich auch in Komorbiditätsraten nach DSM-IV im Bereich von 10–29 % wider (Beidel et al., 1999). Somit stellt nach DSM-IV die Generalisierte Angststörung die häufigste Komorbidität dar.
Merke: Unterschiede andere Angststörungen und Soziale Angststörung
Die Soziale Angststörung tritt sehr häufig komorbid mit anderen Angststörungen auf. Verhaltensweisen (z. B. Verweigerung des Schulbesuchs) sind dabei nur begrenzt aussagekräftig. Somit ist die Erfassung angstspezifischer Kognitionen (z. B. Angst vor anderen Kindern, vor Prüfungen oder vor Trennung von den Eltern) zentral für die Diagnosestellung.
3.1.2 Selektiver Mutismus
Selektiver Mutismus 4 (ICD-10: F94.0) umfasst das Verstummen in Situationen, in denen eigentlich die soziale Erwartung des Sprechens besteht (z. B. Schule). In anderen Situationen hingegen kann das Kind sprechen. Das Verhalten liegt mindestens einen Monat vor und ist keine Folge einer Tiefgreifenden Entwicklungsstörung, Kommunikationsstörung oder psychotischen Störung (American Psychiatric Association [APA], 2015). Einzelne Studien berichten eine Komorbidität von ca. 8 % (Beidel et al., 1999). Laut Metaanalysen zeigt sich der Selektive Mutismus insbesondere bei jüngeren Kindern häufig als komorbide Diagnose. Bislang ist noch nicht vollständig geklärt, ob das Schweigen in sozialen Situationen eine Extremform der Vermeidung eines Kindes mit Sozialer Angststörung ist, statt einer separaten Störung (Bögels et al., 2010). Bei sehr jungen Kindern wäre es denkbar, dass das Verstummen ein gelerntes Sicherheitsverhalten ist, um der sozialen Situation in der Schule möglichst effektiv aus dem Wege zu gehen. Klinisch betrachtet ist es auch bei Vorliegen sozialer Angstsymptome durchaus sinnvoll, eine separate Diagnose des Selektiven Mutismus zu vergeben, um der Spezifizität des Störungsbildes Raum zu geben und eine passende Behandlung des mutistischen Verhaltens einzuleiten (Bögels et al., 2010).
Merke: Unterschiede Selektiver Mutismus und Soziale Angststörung
Auffälligkeiten in der Sprache wie z. B. Schweigen liegen bei der Sozialen Angststörung häufig nur zu Beginn einer sozialen Situation vor. Sollte das Schweigen länger andauern, ist es meist nicht durch oppositionelle Faktoren erklärbar, wie es beim Selektiven Mutismus der Fall sein kann.
3.1.3 Depressive Störungen
Fast die Hälfte aller Betroffenen mit Sozialer Angststörung leidet im Laufe ihres Lebens an einer depressiven Erkrankung (Last, Perrin, Hersen & Kazdin, 1992). Eine depressive Episode äußert sich über niedergedrückte Stimmung, verminderten Antrieb, Interessenlosigkeit sowie häufig einen sozialen Rückzug (ICD-10: F 32, WHO, 1994). Zur Diagnosestellung müssen die Symptome klinisch bedeutsamen Leidensdruck erzeugen oder eine Beeinträchtigung im Alltag mit sich bringen (z. B. Schule, Familie). Mädchen scheinen häufiger vom komorbiden Auftreten einer Sozialen Angststörung und Depression betroffen zu sein (Epkins & Heckler, 2011).
Merke: Unterschiede Affektive Störungen und Soziale Angststörung
Der soziale Rückzug tritt bei der depressiven Episode nicht aus Angst vor Abweisung durch andere, sondern aus Antriebslosigkeit oder Interessenlosigkeit auf. Rumination (Gedankenkreisen) ist bei beiden Störungsbildern beobachtbar, unterscheidet sich jedoch teilweise bzgl. der Inhalte und des Auftrittszeitpunkts (Soziale Angststörung: primär nach der Situation, Depression: primär vor der Situation).
In der Regel liegt zunächst die Soziale Angststörung vor (Essau, Conradt & Petermann, 2000). Einem früheren Beginn der Sozialen Angststörung (Kindheit vs. Jugend) folgt oft ein schnellerer Beginn einer depressiven Episode sowie ein schwerwiegender Verlauf dieser (Cummings, Caporino & Kendall, 2014). Tatsächlich gilt die Soziale Angststörung als Risikofaktor für die Entwicklung einer depressiven Störung (Stein et al., 2001), wenngleich einer Sozialen Angststörung nicht immer eine depressive Episode folgt und einer depressiven Episode nicht unbedingt eine Soziale Angststörung vorausgeht (Epkins & Heckler, 2011). Es ist davon auszugehen, dass (soziale) Angst und Depression gemeinsame Grundlagen aufweisen. So zeigt sich bei beiden Störungsbildern erhöhter Neurotizismus bzw. negative Affektivität, verminderte Extraversion bzw. positive Affektivität, teilweise gepaart mit geringerer Kontrolle über die eigene Emotionalität als prädiktiv für die Entwicklung einer Störung (Epkins & Heckler, 2011). Das Zusammenspiel dieser Temperamentsfaktoren mit bestimmten Umweltfaktoren wie z. B. als gering wahrgenommene elterliche Unterstützung oder elterliche Psychopathologie trägt zusätzlich zum Entstehen depressiver und sozial ängstlicher Symptomatik bei. Darüber hinaus scheinen bestimmte genetische Grundlagen für die Entstehung von Angst und Depression übereinzustimmen (Epkins & Heckler, 2011). Neben den Überlegungen gemeinsamer Entwicklungsfaktoren für Angst und Depression ist aufgrund der aufeinanderfolgenden Entstehung von zunächst Sozialer Angststörung und im Anschluss Depression eine generelle Vulnerabilität für Angst aus Temperaments-, biologischen und Umweltfaktoren denkbar, aus welcher sich bei fehlender Behandlung schließlich eine depressive Episode entwickelt (Cummings et al., 2014). Ein kognitiver Erklärungsversuch beschreibt die Rumination als ausschlaggebenden Faktor: Aufgrund der Sozialen Angststörung tendieren Patient*innen zu einem negativen Fokus in ihren Gedanken an die soziale Situation. Die Rumination wiederum ist ein Risikofaktor für die Entwicklung einer depressiven Störung (Nolen-Hoeksema, 2000). Ein weiteres Modell beschreibt die Entwicklung der depressiven Symptomatik, indem aufgrund des starken Rückzugverhaltens keine positiven sozialen Verstärker mehr vorliegen und sich somit eine depressive Symptomatik entwickelt (Cummings et al., 2014). Je länger eine Angststörung im Allgemeinen anhält, desto wahrscheinlicher wird insbesondere die Komorbidität mit einer depressiven Erkrankung (In-Albon, 2011). Bei Vorliegen von beiden Erkrankungen verstärkt die depressive Symptomatik kognitive Verzerrungen, die der Sozialen Angststörung angehören, wie z. B. negative Grundannahmen über die eigene Person aufgrund von als negativ wahrgenommenen sozialen Ereignissen (Cummings et al., 2014). Neben vorliegenden Risikofaktoren wie z. B. einer negativen Affektivität wird der Umgang mit ambivalenten oder negativen Situationen als relevant für eine Störung betrachtet. Dieses sogenannte Coping stellt oft einen moderierenden Faktor dar (Epkins & Heckler, 2011), d. h. ein hoher negativer Affekt kann durch funktionale Copingstrategien ausgeglichen werden und somit keine ängstlichen oder depressiven Symptome mit sich bringen, während dysfunktionale Copingstrategien das Risiko für die Entwicklung einer Depression oder Sozialen Angststörung erhöhen. Bei der Betrachtung von Copingstrategien zeigen sich Unterschiede zwischen primär ängstlichen und primär depressiven Kindern (siehe Forschung; Wright, Banerjee, Hoek, Rieffe & Novin, 2010).
Читать дальше