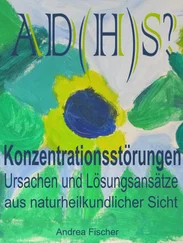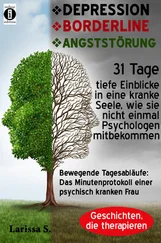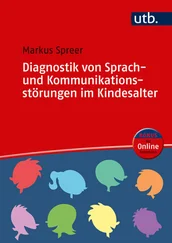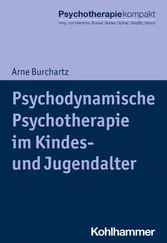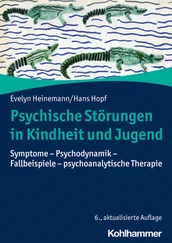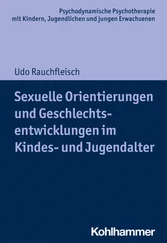2.3 Folgen einer Sozialen Angststörung
Studien weisen darauf hin, dass eine Soziale Angststörung im Kindes- und Jugendalter sehr negative Auswirkungen in verschiedenen Lebensbereichen von Betroffenen hat, wie auch im Fallbeispiel zu Beginn dieses Kapitels. So berichten Kinder mit Angststörungen, darunter auch die Soziale Angststörung, von mehr negativen Interaktionen mit Gleichaltrigen, mehr Ablehnung durch Gleichaltrige und einem insgesamt deutlich herabgesetzten Selbstwert (Ginsburg, La Greca & Silverman, 1998). Negative Erfahrungen und Ausgrenzungen durch Peers können dabei sowohl die Entwicklung von sozialen Ängsten begünstigen, als auch die Folge einer Sozialen Angststörung sein. Die vermehrte Ausgrenzung als Folge von sozialen Ängsten liegt möglicherweise darin begründet, dass sozialängstliche Kinder und Jugendliche sich sozial ungeschickter verhalten und sich bei Ausgrenzung und Bullying weniger wehren als Kinder ohne Soziale Angststörung (Ranta, Kaltiala-Heino, Fröjd & Marttunen, 2013). Hinsichtlich der schulischen Leistungen zeigen sich ebenfalls Hinweise auf einen starken negativen Einfluss von Ängsten. So berichten Erwachsene mit verschiedenen Angststörungen, einschließlich der Sozialen Angststörung, dass starke soziale Ängste der Hauptgrund für einen frühzeitigen Schulabbruch in der Jugend waren (Van Ameringen, Mancini & Farvolden, 2003). Im Hinblick auf das familiäre Umfeld scheint eine Soziale Angststörung im Kindes- und Jugendalter mit vermehrt negativem Elternverhalten wie Überbehütung oder weniger positiver Interaktion assoziiert zu sein, wobei unklar bleibt, ob die negative familiäre Interaktion Ursache oder Folge von kindlichen Angstsymptomen ist (Asbrand, Hudson, Schmitz & Tuschen-Caffier, 2017). Da insbesondere negative interpersonelle Erfahrungen zwischen Kindern und Familienmitgliedern aber auch Peers wichtige aufrechterhaltende Faktoren für die Störung sein können, kann deren Einbezug in die Psychotherapie (z. B. Interventionen zum Aufbau von Kontakten mit Gleichaltrigen) wichtig sein.
2.4 Veränderungen durch Psychotherapie und Behandlungserwartung
Hinsichtlich des Verlaufs der Sozialen Angststörung stellt sich für die Psychotherapie die Frage, welcher Verlauf der Störung unter Behandlung im Hinblick auf die Symptomatik der Sozialen Angststörung aber auch mögliche negative psychosoziale Folgen zu erwarten ist (z. B. keine altersentsprechende soziale Integration bei Nichtbehandlung). Eine weitere wichtige Rolle spielt auch die Erwartung hinsichtlich des Behandlungserfolgs von Kindern und Jugendlichen selbst, aber auch wichtiger Bezugspersonen wie Eltern, Familienangehöriger oder Lehrkräfte. Grundsätzlich zeigt sich (  Kap. 7), dass eine kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung bei der Mehrheit der Kinder und Jugendlichen zu einem Absinken der Symptomatik unterhalb der klinischen Schwelle führt (Spence, Donovan & Brechman-Toussaint, 2000) und die Behandlungserfolge insgesamt stabil sind. Auf der anderen Seite zeigen Studien auch, dass bei einem Teil der behandelten Kinder und Jugendlichen die Sozialen Angststörung auch nach Psychotherapie weiter bestehen kann (Herbert et al., 2009).
Kap. 7), dass eine kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung bei der Mehrheit der Kinder und Jugendlichen zu einem Absinken der Symptomatik unterhalb der klinischen Schwelle führt (Spence, Donovan & Brechman-Toussaint, 2000) und die Behandlungserfolge insgesamt stabil sind. Auf der anderen Seite zeigen Studien auch, dass bei einem Teil der behandelten Kinder und Jugendlichen die Sozialen Angststörung auch nach Psychotherapie weiter bestehen kann (Herbert et al., 2009).
In der psychotherapeutischen Behandlung sollte darüber informiert werden, welche realistischen Erwartungen Patient*innen hinsichtlich der Psychotherapie haben können, aber auch welche möglichen unrealistischen Erwartungen vorliegen ( Tab. 2.1). Insbesondere, wenn Patient*innen oder Angehörige unrealistisch hohe Erwartungen an die Psychotherapie haben, wie z. B. dass innerhalb von kurzer Zeit alle Symptome der Sozialen Angststörung verschwinden werden, führt das in vielen Fällen zu Frustration und einem Absinken der Behandlungsadhärenz. Neben überzogenen Behandlungserwartungen sollten Familien darüber aufgeklärt werden, dass die Symptomatik der Störung auch während der Behandlung schwanken kann, z. B. wenn punktuelle Belastungsfaktoren, wie Schulwechsel oder Elternkonflikte, hinzukommen. Wichtig ist, Patient*innen und Bezugspersonen darauf vorzubereiten, dass solche Schwankungen normal sind und nicht bedeuten, dass die psychotherapeutische Behandlung keinen Erfolg hat. Wenn derartige Schwankungen mehrfach auftreten, kann es in späteren »Krisen« hilfreich sein, auf frühere Verschlechterungen Bezug zu nehmen und die positive Bewältigung in der Vergangenheit zu betonen.
Tab. 2.1: Realistische vs. unrealistische Behandlungserwartungen
Realistische BehandlungserwartungenUnrealistische Behandlungserwartungen
2.5 Überprüfung der Lernziele
• Wie häufig ist die Soziale Angststörung im Kindes- und Jugendalter?
• Welchen Verlauf nehmen starke soziale Ängste in den meisten Fällen bei Kindern und Jugendlichen?
• Was sind häufige negative Folgen einer Sozialen Angststörung im Kindes- und Jugendalter?
• Was sind realistische und unrealistische Erwartungen hinsichtlich des Störungsverlaufs unter psychotherapeutischer Behandlung?
3 Komorbidität und Differenzialdiagnostik
Fallbeispiel
Der 13;4-jährige Hannes berichtet bei der Erstvorstellung in der kinder- und jugendpsychotherapeutischen Ambulanz von zahlreichen Ängsten. So habe er große Angst vor Prüfungen in der Schule, aber auch davor, dass ein Krieg ausbrechen könne, seinen Eltern etwas zustoße, oder dass ihm selbst etwas passieren könne. Bei genauerer Exploration schildert er vor allem Ängste im sozialen Bereich: Er habe insbesondere Angst davor, irgendwann auf sich gestellt zu sein und mit anderen nicht in Kontakt treten zu können. Kognitiv schildert er vor allem die Sorge, in der Schule nicht gut genug zu sein, um später einen guten Beruf ergreifen zu können. Wenn er so viel nachdenke, sei er oft niedergeschlagen und ziehe sich zurück. Phasenweise schlafe er dann nur wenig und esse kaum etwas. Differenzialdiagnostisch zeigt sich eine Soziale Angststörung mit rezidivierenden depressiven Phasen. Subklinisch liegen Symptome einer Generalisierten Angststörung vor.
• Sie können die häufigsten Komorbiditäten benennen und z. B. Ursachen für das gemeinsame Auftreten beschreiben.
• Sie können die Soziale Angststörung von der Generalisierten Angststörung abgrenzen.
• Sie können die Soziale Angststörung von einer Tiefgreifenden Entwicklungsstörung abgrenzen.
• Sie können die Soziale Angststörung vom Schulabsentismus abgrenzen.
Ungefähr zwei Drittel aller Patient*innen mit Sozialer Angststörung berichten über weitere komorbid auftretende psychische Störungen (Szafranski, Talkovsky, Farris & Norton, 2014). Insbesondere die generalisierte Form der Sozialen Angststörung ist geprägt von hoher Komorbidität mit depressiven Störungen (v. a. Major Depression), anderen Angststörungen und auch dem Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS; Chavira, Stein, Bailey & Stein, 2004). Aufgrund des frühen Beginns der Sozialen Angststörung tritt die komorbide Erkrankung meist in der Folge auf (Rapee & Spence, 2004; Spence & Rapee, 2016). Es ist denkbar, dass eine komorbide Störung Vermeidungs- und Rückzugsverhalten noch weiter fördert, sodass generell mit Vorliegen einer komorbiden Störung die wahrgenommene Lebensqualität noch weiter sinkt als mit einer Sozialen Angststörung (Szafranski et al., 2014).
In der Diagnostik der Sozialen Angststörung ist zunächst zu differenzieren, ob eine Störung komorbid vorliegt oder ob nicht etwa eine andere Störung die Symptomatik besser erklärt (  Kap. 3.2). Besonders häufig komorbid auftretende Störungen sind andere Angststörungen und affektive Störungen.
Kap. 3.2). Besonders häufig komorbid auftretende Störungen sind andere Angststörungen und affektive Störungen.
Читать дальше
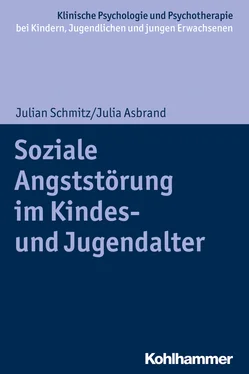
 Kap. 7), dass eine kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung bei der Mehrheit der Kinder und Jugendlichen zu einem Absinken der Symptomatik unterhalb der klinischen Schwelle führt (Spence, Donovan & Brechman-Toussaint, 2000) und die Behandlungserfolge insgesamt stabil sind. Auf der anderen Seite zeigen Studien auch, dass bei einem Teil der behandelten Kinder und Jugendlichen die Sozialen Angststörung auch nach Psychotherapie weiter bestehen kann (Herbert et al., 2009).
Kap. 7), dass eine kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung bei der Mehrheit der Kinder und Jugendlichen zu einem Absinken der Symptomatik unterhalb der klinischen Schwelle führt (Spence, Donovan & Brechman-Toussaint, 2000) und die Behandlungserfolge insgesamt stabil sind. Auf der anderen Seite zeigen Studien auch, dass bei einem Teil der behandelten Kinder und Jugendlichen die Sozialen Angststörung auch nach Psychotherapie weiter bestehen kann (Herbert et al., 2009). Kap. 3.2). Besonders häufig komorbid auftretende Störungen sind andere Angststörungen und affektive Störungen.
Kap. 3.2). Besonders häufig komorbid auftretende Störungen sind andere Angststörungen und affektive Störungen.