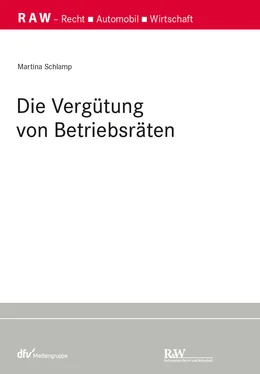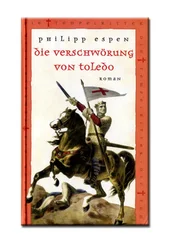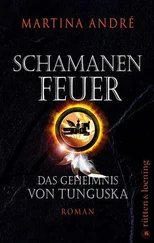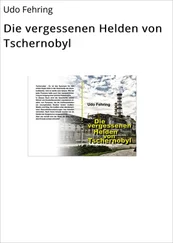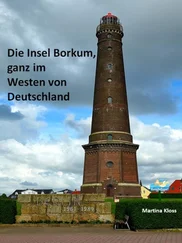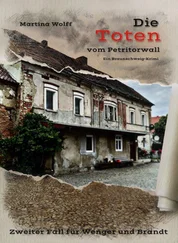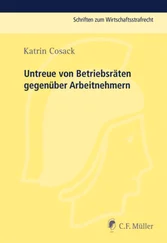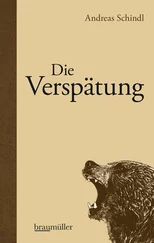Das BAG schließt dagegen jegliche Vergütung von Betriebsräten wegen oder aufgrund des Amtes aus und sieht auch in § 37 Abs. 3 S. 3 BetrVG keine Durchbrechung des uneingeschränkt geltenden Unentgeltlichkeitsgrundsatzes.171 Nach Ansicht des BAG ist Betriebsratsarbeit grundsätzlich während der Arbeitszeit vorzunehmen. Der Freizeitausgleich stelle lediglich eine Folge der ausnahmsweisen Abweichung von diesem Grundsatz auf Betreiben des Arbeitgebers dar; die hier vorgesehene zusätzliche Vergütung sei im Ergebnis „zeitlich verschobenes Arbeitsentgelt für eine sonst in der persönlichen Arbeitszeit anfallende Betriebsratsarbeit, die nur infolge eines dem Arbeitgeber zurechenbaren Umstands in die Freizeit verlegt worden ist“.172 Hierin liege nach Ansicht des BAG kein anderer gesetzlicher Regelungsplan, der abweichend von dem unentgeltlichen Ehrenamt eine angemessene Vergütung für Freizeitopfer vorsehe.173 Vielmehr sei der Anspruch auf zusätzliche Vergütung nur eine Kompensation für den eigentlich vorrangig durchzuführenden Freizeitausgleich, der nur aus arbeitgeberseitigen Gründen nicht zeitnah möglich ist.174
Auch in der Literatur wird eine Charakterisierung als Ausnahme von dem Ehrenamtsprinzip – konsequenterweise eigentlich von dem Unentgeltlichkeitsprinzip – abgelehnt und nur als Ausgleich für mögliche unzulässige Benachteiligungen verstanden.175
Tatsächlich darf hier nicht allein aufgrund des Wortlautes der Regelung, der den Begriff „vergüten“ verwendet, losgelöst von dem Gesamtzusammenhang bereits auf eine (ausnahmsweise) Entgeltlichkeit des Betriebsratsamtes geschlossen werden. Wie das BAG zutreffend ausführt, kann es sich hier nicht um einen neuen Regelungskomplex handeln, der nur für den Fall, dass Betriebsratstätigkeit außerhalb der persönlichen Arbeitszeit durchgeführt werden muss, eine Vergütung vorsieht. Betrachtet man auch die Stellung der Regelung innerhalb des § 37 BetrVG, ist klar, dass das in Absatz 1 genannte Unentgeltlichkeitsprinzip damit nicht verdrängt werden soll. Die Regelung in Absatz 3 betrifft nur den Ausgleich für Freizeitopfer, der wiederum nur unter bestimmten Voraussetzungen und vor allem erst nach erfolglosem Freizeitausgleich, nachrangig einen entsprechenden Ausgleich in Geld vorsieht. Eine Entgeltlichkeit des Betriebsratsamtes vermag dies nicht zu begründen. Dennoch bleibt hier aber zumindest festzuhalten, dass das Betriebsverfassungsgesetz trotz der eindeutigen Regelung in § 37 Abs. 1 BetrVG es unter bestimmten Umständen zulässt bzw. sogar anordnet, dass (wirtschaftliche) Nachteile, die mit dem Amt verbunden sind, zu einem Ausgleich gebracht werden.
Nicht geldwerte, immaterielle Vorteile, die dem Betriebsratsmitglied wegen seines Amtes gewährt werden, sind schon wegen des Wortlautes von vornherein nicht von dem Unentgeltlichkeitsprinzip des § 37 Abs. 1 BetrVG erfasst.176 Denkbar ist zwar, dass der Arbeitgeber einen Mandatsträger beispielsweise mit besonderen Titeln oder Positionen ausstattet, die für das jeweilige Betriebsratsmitglied einen lediglich immateriellen Wert haben. Die spezielle Regelung in § 37 Abs. 1 BetrVG bezieht sich aber ausschließlich auf geldwerte Besserstellungen177 und zwar nur im Hinblick auf die Vergütung von Betriebsratsmitgliedern aufgrund ihres Amtes. Die Erstreckung des Grundsatzes auch auf nicht geldwerte Vorteile würde den Begriff der Unentgeltlichkeit zu weit ausdehnen.178 Ein immaterieller Wert vermag es keinesfalls, das Betriebsratsamt in ein entgeltliches Amt zu verkehren. Auch besteht hier keine Regelungslücke, die eine andere Beurteilung rechtfertigen würde. Denn auch wenn die Gewährung immaterieller Vorteile an Betriebsratsmitglieder zwar nicht gegen den Unentgeltlichkeitsgrundsatz verstößt, können solche Vorteile aber nach dem Begünstigungsverbot des § 78 S. 2 BetrVG unzulässig sein.179
4. Versprechen und Vereinbarungen von Leistungen
Versprechen an Betriebsratsmitglieder, die zusätzliche Leistungen für diese vorsehen, werden in der Kommentarliteratur fast ausschließlich dem tatsächlichen Gewähren solcher Zuwendungen gleichgestellt bzw. wegen Verstoßes gegen das Unentgeltlichkeitsprinzip nach § 37 Abs. 1 BetrVG als unzulässig erachtet, ohne dass für diese Annahme eine Begründung genannt wird.180
Dieser Auffassung kann im Hinblick auf § 37 Abs. 1 BetrVG nicht zugestimmt werden. Gibt der Arbeitgeber einem gewählten Betriebsratsmitglied sein Versprechen, dass er ihm in Zukunft ein höheres Entgelt oder eine zusätzliche Pauschale gewähren wird, hat der Mandatsträger zu diesem Zeitpunkt weder eine konkrete Zahlung noch einen geldwerten Vorteil erhalten. Vielmehr hat das Betriebsratsmitglied lediglich die Aussicht, in absehbarer Zeit eine solche Leistung zu empfangen. Zwar könnte der Schutzzweck der Norm, insbesondere die Unabhängigkeit der Mandatsträger, bereits durch ein Inaussichtstellen von geldwerten Vorteilen durchaus gefährdet sein, weil auch schon die Erwartung bzw. die Hoffnung auf eine bestimmte Zahlung das Betriebsratsmitglied in seinem Handeln beeinflussen kann. Auf der anderen Seite ist aber fraglich, welche Verbindlichkeit einem solchen Versprechen zukommt; dies lässt sich nur schwer beurteilen und nicht allgemein festlegen, sondern hängt von verschiedenen Umständen, unter anderem der Person des Versprechenden, ab. Ein Verstoß gegen das Unentgeltlichkeitsprinzip müsste dann auf Mutmaßungen gestützt werden, ob ein Versprechen auf zusätzliche Leistungen hinreichend wahrscheinlich auch eingehalten und tatsächlich umgesetzt wird, anderenfalls würde man einen Verstoß schon bei noch unsicheren Ereignissen in der Zukunft bejahen. Allein der Schutzzweck der Vorschrift rechtfertigt daher noch nicht die Subsumtion eines bloßen Versprechens einer Leistung unter den Begriff Unentgeltlichkeit. Das wäre mit dem Wortlaut des § 37 Abs. 1 BetrVG nicht vereinbar und würde dessen Anwendungsbereich zu weit ausdehnen. Da es an einer tatsächlichen Leistung oder einem tatsächlich eingetretenen Vorteil und damit an einer Besserstellung fehlt, ist ein Versprechen auf eine zusätzliche Leistung nicht nach § 37 Abs. 1 BetrVG unzulässig. Solche Fälle können aber gegen das Begünstigungsverbot nach § 78 S. 2 BetrVG verstoßen und gegebenenfalls i.V.m. § 134 BGB nichtig sein.181
Ähnlich verhält es sich mit Vereinbarungen, beispielsweise in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen sowie individuellen Abreden in Arbeitsverträgen, die Zuwendungen an Betriebsratsmitglieder zum Inhalt haben.
Trotz der vergleichbaren Konstellation sind solche Abreden nicht mit bloßen Versprechen gleichzusetzen, sondern getrennt zu betrachten und zu beurteilen. Es handelt sich bei dem Begriff des Versprechens entgegen einer Auffassung im Schrifttum nicht um eine mehrdeutige Bezeichnung, zu deren genaueren Bestimmung ein Rückgriff auf strafrechtliche Begrifflichkeiten der Bestechungsdelikte nach §§ 331 StGB erforderlich wäre und unter die auch vertragliche Vereinbarungen zu fassen sind.182 Auch wenn die Fälle von Leistungsversprechen an Betriebsratsmitglieder in der Kommentarliteratur überwiegend in Zusammenhang mit entsprechenden Vereinbarungen bewertet werden,183 bedeutet dies nicht, dass hier kein Unterschied zwischen den beiden Varianten zu machen ist.184 Es ist vielmehr anzunehmen, dass die Fälle nur aufgrund der ähnlichen Sachlage gemeinsam genannt werden.
Zwischen den beiden Konstellationen besteht ein bedeutender Unterschied, der für die Beurteilung der Zulässigkeit entscheidend ist. Während ein Versprechen nur einseitig gegeben wird, sind bei Vereinbarungen dagegen zwei Parteien beteiligt, die sich über einen bestimmten Inhalt einig werden. Zwar ist es durchaus möglich, dass ein bislang unverbindliches Versprechen auch in einer vertraglichen Vereinbarung festgehalten wird, das ist aber nicht automatisch oder zwingend der Fall. Im Gegensatz zu bloßen Versprechen weisen Vereinbarungen durchaus einen verbindlichen Charakter auf. Zwar geben sie selbst noch keinen direkten geldwerten Vorteil, sie können aber einen Rechtsanspruch – zum Beispiel auf eine vereinbarte Zusatzleistung – begründen.
Читать дальше