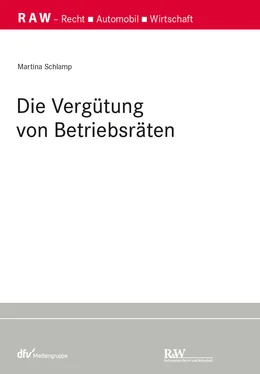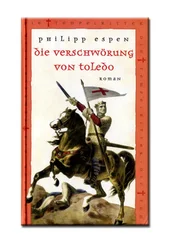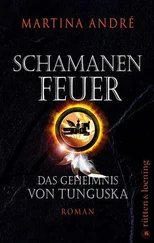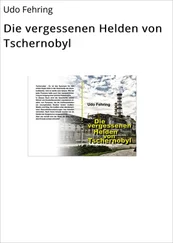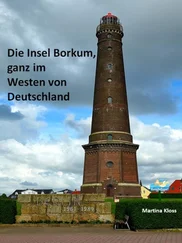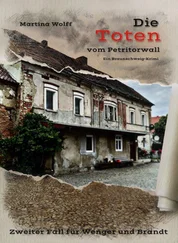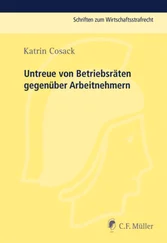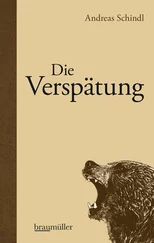Daher stellt sich hier die Frage, ob eine solche Forderung bereits eine so gefestigte Aussicht auf eine zusätzliche Leistung darstellt, dass entsprechende Vereinbarungen unter das Unentgeltlichkeitsprinzip nach § 37 Abs. 1 BetrVG fallen und damit unzulässig sind. Denkt man auch hier zunächst an den Schutzzweck der Norm, liegt die Annahme nahe, dass die Unabhängigkeit eines Betriebsratsmitgliedes durch entsprechende vertragliche Abreden bereits gefährdet ist. Teilweise wird dies mit der Begründung vertreten, dass sich der Mandatsträger damit bereits auf die Besserstellung eingelassen hat.185 Ob jedoch bei jeder Vereinbarung mit einer generalisierten Betrachtungsweise automatisch von dem Verlust bzw. der Gefährdung der Unabhängigkeit eines Betriebsratsmitgliedes auszugehen ist, bleibt zweifelhaft. § 37 Abs. 1 BetrVG betrifft ausschließlich die Unentgeltlichkeit der Amtsführung, verbietet also jede tatsächliche Vergütung. Dass es nicht darauf ankomme, ob die vereinbarte Zahlung letztlich auch tatsächlich gewährt wird,186 dem ist nicht zu folgen. Es ist – gerade auch im Rahmen des § 37 Abs. 1 BetrVG – zwischen der schuldrechtlichen Verpflichtung auf zukünftige Leistungen einerseits und dem tatsächlichen Gewähren von Zuwendungen andererseits zu unterscheiden. Eine schuldrechtliche Vereinbarung auf eine künftige Leistung bedeutet per se nämlich nicht, dass eine Leistung auch wirklich erfolgt. Würde eine entsprechende Abrede zwar geschlossen, aber – aus vielerlei denkbaren Gründen – dann nicht erfüllt werden, wäre eine Unzulässigkeit der Vereinbarung zu Unrecht angenommen worden. Das könnte zwischenzeitlich weitere, nicht umkehrbare Rechtsfolgen ausgelöst haben. Da sich das Unentgeltlichkeitsprinzip ebenso gegen die Betriebsratsmitglieder selbst richtet und daher ein Verstoß dagegen auch eine Amtspflichtverletzung darstellen kann, wäre ein Ausschluss des Mandatsträgers aus dem Betriebsrat nach § 23 Abs. 1 BetrVG denkbar,187 obwohl keine zusätzlichen Leistungen gewährt wurden. Natürlich lässt sich hier anführen, dass Sinn und Zweck der Regelung ist, bereits im Vorfeld mögliche Unabhängigkeitsgefährdungen von Betriebsratsmitgliedern auszuräumen. Der Anwendungsbereich des § 37 Abs. 1 BetrVG würde damit aber über seinen Wortlaut hinaus zu weit ausgedehnt, so dass im Ergebnis auch bei vertraglichen Vereinbarungen ein Verstoß jedenfalls gegen das Unentgeltlichkeitsprinzip nicht angenommen werden kann. Solche Vereinbarungen können gegebenenfalls jedoch gegen das Begünstigungsverbot des § 78 S. 2 BetrVG verstoßen.188
5. Zahlungen durch Arbeitnehmer oder sonstige Dritte
Bei dem Unentgeltlichkeitsprinzip des § 37 Abs. 1 BetrVG macht es keinen Unterschied, von wem ein geldwerter Vorteil gewährt wird. In der Praxis betrifft dies in erster Linie Zahlungen des Arbeitgebers an Betriebsratsmitglieder, aber auch Zuwendungen seitens der Arbeitnehmer oder sonstiger Dritter sind unzulässig. Die Regelung richtet sich nach einhelliger Meinung gegen jedermann.189 Zwar ist der Gedanke grundsätzlich nicht abwegig, den Betriebsratsmitgliedern finanzielle Zuschüsse durch die Arbeitnehmer im Betrieb zukommen zu lassen – schließlich setzen diese sich überwiegend für die Interessen der Belegschaft ein. Denkbar wäre beispielsweise, dass Arbeitnehmer freiwillige Spenden abgeben oder regelmäßige Abgaben leisten und ihren Betriebsrat damit finanziell unterstützen. Solche Beiträge sind aber bereits wegen des Umlageverbotes des § 41 BetrVG unzulässig. Vorstellbar wäre auch eine Finanzierung des Betriebsrates und seiner Mitglieder von dritter Seite außerhalb des Betriebes, insbesondere durch die Gewerkschaften. Diese könnten einen Teil ihres eingenommenen Geldes den Betriebsräten in den jeweiligen Betrieben zur Verfügung stellen. Schließlich geht es bei dem Betriebsrat ebenso wie bei der Gewerkschaft um die Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen, bei ersterem auf Betriebsebene und bei letzterer für die jeweiligen Mitglieder. Die Interessenlage ist zumindest ähnlich und für die Gewerkschaften könnte es sogar Vorteile haben, wenn bestimmte Interessen bereits auf Betriebsebene durchgesetzt werden würden.
Allerdings widerspräche eine solche Unterstützung von außen, wenn sie Vergütungscharakter besitzt, dem Unentgeltlichkeitsprinzip. Denn das kann sich nicht ausschließlich auf Leistungen seitens des Arbeitgebers beschränken. Zwar lässt sich dem Wortlaut des § 37 Abs. 1 BetrVG oder der Gesetzesbegründung nicht entnehmen, dass das Verbot Zuwendungen an Betriebsratsmitglieder von jedermann betrifft, zugleich wurde es aber auch nicht auf einzelne Personen(-gruppen) beschränkt. Zieht man den Sinn und Zweck der Vorschrift heran, nämlich die Gewährleistung innerer Unabhängigkeit der Betriebsratsmitglieder sowie die Unbestechlichkeit zugunsten einer freien, unabhängigen Meinungsbildung, so muss das Unentgeltlichkeitsprinzip als ein generelles Verbot von Zuwendungen verstanden werden.190 Denn eine Beeinflussung von Betriebsratsmitgliedern mit finanziellen Mitteln muss nicht zwingend durch den Arbeitgeber erfolgen. Auch andere Betriebsangehörige oder außenstehende Personen bzw. Verbände könnten durch entsprechende Zahlungen durchaus Einfluss auf die Mandatsträger nehmen.
Die Regelung wäre außerdem leicht zu umgehen,191 würde man Zuwendungen von Dritten als zulässig erachten, beispielsweise durch eine Einflussnahme des Arbeitgebers über Tochtergesellschaften des Unternehmens. Im Falle von Zahlungen durch Gewerkschaften würden die Grenzen zwischen beiden Institutionen zu sehr verwischen. Dass die Gewerkschaften dadurch auch mehr Einfluss im Betrieb erlangen könnten, dürfte zum einen nicht im Sinne des Arbeitgebers sein und wäre zum anderen wohl auch im Hinblick auf das Arbeitskampfverbot der Betriebsratsmitglieder gemäß § 74 Abs. 2 S. 1 BetrVG kritisch zu sehen.
Leistungen mit Vergütungscharakter sind daher nicht nur von Arbeitgeberseite, sondern ebenso von Dritten von dem Unentgeltlichkeitsgrundsatz des § 37 Abs. 1 BetrVG erfasst und daher unzulässig.
II. Ergänzung durch Nachteilsverbot und Ersatz notwendiger Auslagen
Der Grundsatz in § 37 Abs. 1 BetrVG sieht vor, dass die Betriebsratsmitglieder aus ihrem Amt keinen geldwerten Vorteil ziehen sollen, der nicht ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist.192 Die Kehrseite dazu stellt der Ausschluss sämtlicher Benachteiligungen dar. Die Mandatsträger sollen durch die Amtsübernahme ebenso wenig finanzielle Einbußen erleiden. Dem Unentgeltlichkeitsprinzip steht daher das Verbot jeglicher wirtschaftlicher Nachteile gegenüber. Dazu gehört auch, dass die notwendigen Auslagen, welche die Betriebsratstätigkeit mit sich bringt, ersetzt werden.193 In Rechtsprechung und Literatur werden das Verbot von geldwerten Vorteilen wie auch das von finanziellen Nachteilen meist gemeinsam genannt und zusammen betrachtet.194 Zwar ist ein Verbot von Nachteilen nicht ausdrücklich in der Vorschrift des § 37 Abs. 1 BetrVG angelegt, die beiden Grundsätze sollen sich aber jedenfalls ergänzen195. Obwohl er eigentlich nur jegliche materielle Besserstellung zu vermeiden versucht, wird in der Literatur anscheinend aus dem Unentgeltlichkeitsgrundsatz selbst häufig schon ein Verbot von Nachteilen abgeleitet und dabei nicht immer präzise differenziert. Als Folge der Unentgeltlichkeit, die finanzielle Vorteile zu verhindern versucht, sollen auf der anderen Seite die Mitglieder des Betriebsrates ebenso keine wirtschaftlichen Nachteile erfahren. Nicht zuletzt trägt auch das zur Stärkung des Vertrauens der Belegschaft in die Tätigkeit des sie vertretenden Betriebsrates bei, wenn dieser auch nicht durch den Entzug geldwerter Vorteile beeinflusst wurde.196 Zwar wird in § 78 S. 2 BetrVG das Verbot sowohl der Begünstigung als auch der Benachteiligung von Betriebsratsmitgliedern allgemein festgesetzt, im Hinblick auf die Vergütung bestehen allerdings speziellere Vorschriften.197 Konkret wird dem allgemeinen Benachteiligungsverbot in wirtschaftlicher Hinsicht und insbesondere im Hinblick auf die Vergütung durch die § 37 Abs. 2 bis 6198 und § 40 BetrVG Rechnung getragen. Die Vorschriften stellen sicher, dass die Betriebsratstätigkeit auf Dauer nicht mit (finanziellen) Opfern verbunden ist und den Mandatsträgern keine Vermögensnachteile entstehen.199 Allein auf das Unentgeltlichkeitsprinzip lässt sich das nicht stützen.
Читать дальше