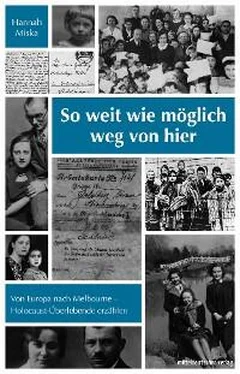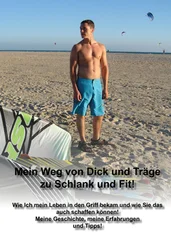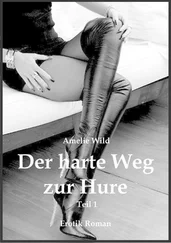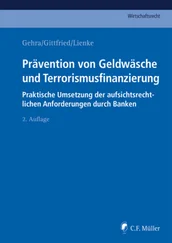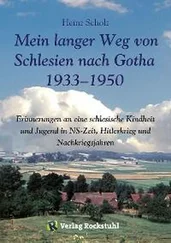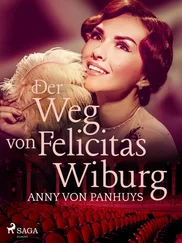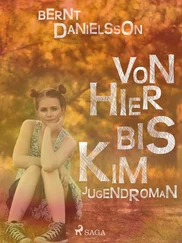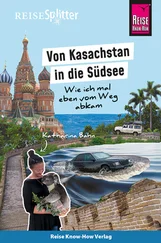Die fünfzehnjährige Maria trifft im Ghetto ihre Schulfreundinnen Irma, Iwetta, Irka und Luisa wieder. Einige der früheren Lehrer organisieren heimlichen Schulunterricht und unterrichten polnische Literatur und Naturwissenschaften. „Wir haben uns jeden Tag in einer anderen Wohnung getroffen, kamen alle einzeln und haben unsere Bücher unter der Kleidung versteckt, um keine Aufmerksamkeit zu erregen.“
Die Mädchen verbringen oft die Nachmittage zusammen – bis 19 Uhr, dann beginnt die nächtliche Ausgehsperre. Eines Tages sind die Mädchen bei Irma verabredet, Maria verspätet sich etwas und trifft weder Irma noch Iwetta oder Irka an. Irgendetwas ist komisch, denn Irmas Mutter möchte nicht sagen, wo die Mädchen sind.
„Erst einige Zeit später hat mir Irmas Vater dann erzählt, was passiert ist. Deutsche waren in das Haus gestürmt und haben fünf Mädchen mitgenommen – darunter Irma, Iwetta und Irka. Dann haben sie die Mädchen in einen Hinterhof gebracht, in dem ein Berg Kohle lag. Die Mädchen mussten sich splitternackt ausziehen und zu den Klängen von Militärmusik die Kohle von einer Ecke des Hofs in die andere Ecke tragen. Nach drei Stunden wurden sie zu ihrem Haus zurückgebracht.“
Maria schüttelt den Kopf und sagt langsam: „Meine Freundinnen haben nie ein einziges Wort über diesen Vorfall verloren.“ Lidia wird von ihrer Schwester Olga mit Briefen bombardiert und der Bitte, doch das Ghetto zu verlassen. Es laufen Gerüchte über Umsiedlungen und Arbeitslager. Olga organisiert Papiere für die Mädchen, damit sie sich als russisch-orthodox eintragen lassen können, und sie organisiert eine Wohnung in Warschau. Irgendwann gibt Lidia nach, und es gelingt ihr und den beiden Mädchen, aus dem Ghetto auf die arische Seite zu gelangen.
„Vermutlich ist das überraschend, was ich jetzt sage, aber so sehr wie ich das Ghetto gehasst habe – denn die Situation im Ghetto verschlimmerte sich nahezu täglich –, ich wollte es wirklich nicht verlassen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich meine Freundinnen im Stich lasse und verrate. Ich habe endlos meiner Mutter gegenüber gejammert, wie allein ich mich ohne meine Freundinnen fühle. Die andere Sache war natürlich, dass wir dauernd davon hörten, dass auf der arischen Seite Juden denunziert werden – davor wenigstens brauchte man im Ghetto keine Angst zu haben.“
Lidia und die Kinder benutzen einen Mittelsmann, um mit ihren Freunden im Ghetto in Verbindung zu bleiben. Die siebzehnjährige Irma schreibt im Frühjahr 1940:
„ … Der Grund, warum ich nicht geschrieben habe, ist, weil ich so schwer arbeiten muss. Abgesehen davon bin ich sehr deprimiert. Ich habe keine Motivation, auch nur irgendetwas zu tun … Es gibt keine großen Veränderungen hier. Ich versuche, nicht daran zu denken, was in zwei oder drei Monaten sein wird. Wir müssen von einem Tag auf den anderen leben, auch wenn das keine erfreuliche Philosophie ist. Entschuldige, dass ich es überhaupt erwähne. Ich frage mich, was der Frühling bringt. Ich bin sicher, dass es einige schwierige Momente geben wird (die Lager!). Aber gleichzeitig hoffe ich, dass die Situation besser wird … Ich wünschte nur, dass diese schwierige Periode in unserem Leben bald vorüber sein wird, denn meine Nerven halten das nicht mehr lange aus. Manchmal, wenn nichts mehr geht, kriege ich einen hysterischen Anfall, und dann bin ich die nächsten Tage etwas ruhiger. Aber dann kommen wieder schlechte Nachrichten zum Beispiel aus Łódź2, und dann kehrt die Traurigkeit zurück … “
Als die deutsche Wehrmacht am 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfällt, schöpfen viele Juden Hoffnung. So auch Irma in ihrem Brief vom 24. Juni:
„ … dies ist der letzte Funken Hoffnung für uns … und er kam gerade im richtigen Moment. Wir sind entsetzlich heruntergekommen und fühlen uns elend. Die kleinste Bagatelle lässt uns in Tränen ausbrechen. Wenn man aber glauben und antizipieren kann, dass etwas passiert, dann kann man den Gürtel noch enger schnallen und ausharren. Dies ist unsere letzte Hoffnung, dass das Schicksal uns das erhoffte Wunder bringt … Hoffentlich passiert es, bevor wir uns in Skelette verwandelt haben, bevor wir komplett entmenschlicht sind, beraubt aller Träume und aller Bestrebungen außer der Suche nach Essen … “
Im Juni 1942 wird der Mittelsmann verhaftet, und die Korrespondenz zwischen den Mädchen hört abrupt auf. Maria traut sich, von einer öffentlichen Telefonzelle aus im Ghetto anzurufen.
„Es gab da ein Telefon in der Werkstatt, in der Irma gearbeitet hat, und so konnte ich mit ihr sprechen. Irma erzählte mir, dass ihre Großmutter an einen unbekannten Ort deportiert worden war und viele Freunde auch und dass sich jeder im Ghetto Sorgen mache um die Deportierten. Und dann sagte sie, dass es nun nicht mehr lange dauern würde, bis die Nazis auch sie und ihre restliche Familie deportieren würden. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber versuchte, sie zu beruhigen. Also sagte ich, dass der Krieg nun bestimmt bald vorbei wäre. Ich meine, als die Deutschen Russland überfielen, haben wir das ja alle gedacht. Aber Irma sagte nur: Es ist eine Lüge, Marka, und du weißt es. Und dann legte sie auf.“
Marias Stimme wird dünn. „Das war das letzte Mal, dass ich mit Irma gesprochen habe.“
Während Lidia Markus mit ihren Töchtern nach Warschau floh, flüchtete ihr Schwager Vitek, der Bruder ihres Mannes, von seinem Wohnort Krakau aus in das russisch besetzte Polen. Mit seiner Frau Inka, seinem elfjährigen Sohn Marek und Julek, dem Bruder seiner Frau, floh er nach Lvov. Ungefähr 100.000 Juden haben hier Zuflucht vor den Deutschen gesucht. Vitek findet eine Wohnung und Arbeit, Marek kann wieder zur Schule gehen. Aber das Glück ist nicht von langer Dauer. Am 30. Juni 1941 besetzen die Deutschen die Stadt und errichten im November ein Ghetto im ärmsten Viertel von Lvov. Mit unglaublicher Brutalität – allein auf dem Weg ins Ghetto werden 5.000 ältere und kranke Juden umgebracht – werden die Juden in das Ghetto getrieben. Vitek und seine Familie befinden sich unter diesen Juden. Im März 1942 erfolgt die erste sogenannte „Aktion“: 15.000 Juden werden in das kürzlich errichtete Vernichtungslager Bełżec bei Lublin gebracht. Im Juli schickt Vitek einen Hilferuf an seine Schwägerin Lidia. Deren Schwester Olga, die noch nicht einmal mit Vitek verwandt ist, bietet sich sofort an, nach Lvov zu reisen, um Vitek und dessen Familie zu retten. Die Reise ist erfolgreich.
„Es war ein gefährliches Unterfangen, aber meine Tante Olga kam tatsächlich mit der ganzen Familie zurück. Sie sahen alle sehr jüdisch aus, insbesondere der kleine Marek. Dem hat meine Tante, Zahnschmerzen vortäuschend, ein Tuch um den Kopf gebunden, so dass man dessen jüdische Gesichtszüge nicht so sah.“
Lidia und die Mädchen rücken zusammen und teilen ihre Warschauer Wohnung mit Vitek, Inka, Marek und Julek.
Mit Verordnung vom 26. Oktober 1939 wird im Generalgouvernement die Kennkartenpflicht eingeführt – graue Karten für die Polen, gelbe Karten für die Juden und blaue für Russen, Ukrainer, Weißrussen und andere Minderheiten.
„Jeder musste sich registrieren lassen, eine Geburtsurkunde vorzeigen und eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass man weder Jude noch Halbjude sei. Ein polnischer Freund sagte uns, wir bräuchten uns keine Sorgen zu machen, weil die polnische Untergrundbewegung die Einwohnermeldeämter unterwandert hätte. Und tatsächlich: Als meine Schwester zögerte, diese Erklärung zu unterschreiben, wurde sie von der Dame hinter dem Schalter energisch dazu aufgefordert. Ich selbst hatte noch nicht mal eine Geburtsurkunde und bekam trotzdem meine arische Kennkarte.“
Der Besitz einer Kennkarte war notwendig, aber nicht hinreichend für Juden oder Halbjuden, um auf der arischen Seite Warschaus zu überleben.
Читать дальше