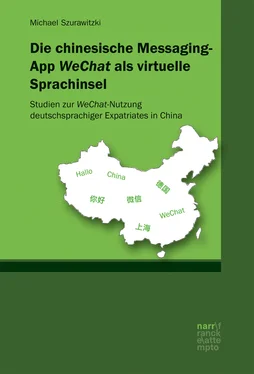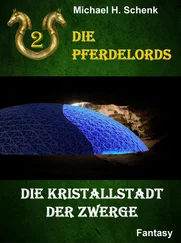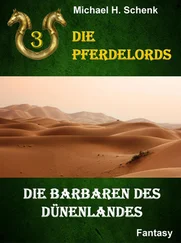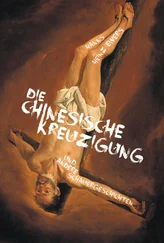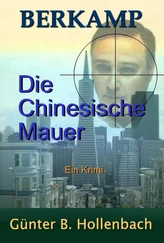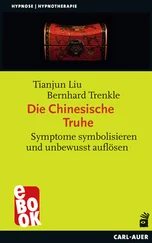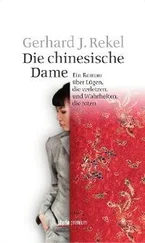Kulturell setzten die Deutschen laut Mühlhahn darauf, die chinesische Kultur über die Vermittlung deutscher Kultur an die Chinesen zu verändern. In einer gemeinsamen Anstrengung von Behörden, Kirchen und privaten Trägern (Mühlhahn 2007: 45) sollte ab 1905 Kiautschou nicht mehr bloß ein Außenposten des deutschen Handels sein, sondern vielmehr eine Art deutsches Kulturzentrum in China: „Die vom Deutschen Reich in Kiautschou systematische betriebene Kulturpolitik sollte neben Diplomatie und Außenwirtschaftspolitik die dritte Säule in den Beziehungen zu China werden.“ (Mühlhahn 2007: 45) Insgesamt stießen diese kommunikativen Bestrebungen bei der chinesischen Bevölkerung während der Kolonialzeit auf eine ambivalente Reaktion: Es gab einerseits Positionen, die die Haltung der Kolonialherren rigoros ablehnten, und andererseits nutzten Menschen die sich ihnen bietenden Chancen, ihre eigene Lebenssituation durch die Interaktion mit den Deutschen zu verbessern. Hierbei sind sowohl Menschen vom Lande zu erwähnen, die sich angesichts ihrer Armut neue Möglichkeiten versprachen, wie auch einige Kaufleute, die von der Situation profitierten (vgl. Mühlhahn 2007: 46).
Grimm/Bauer (1974: Sp. 247) halten fest, dass die Deutschen als Kolonialherren bei den Chinesen insgesamt als – wenn man dies so sagen kann – beliebter gegolten hatten als die größeren Kolonialnationen: „Deutsche galten in China in der Regel als umgängliche Leute. Sie waren weniger typische Kolonialherren als etwa Engländer und Franzosen. […] Deutsche wurden von den Chinesen oft weit freundlicher behandelt als von ihren ehemaligen europäischen Partnern […]“. Insgesamt war aber, wie oben bereits vorweggenommen, die Kolonialzeit auch für das Deutsche Reich nicht von nachhaltigem Erfolg gekrönt. Dennoch bestanden natürlich auch nach der Kapitulation Kiautschous weiterhin deutsch-chinesische Beziehungen, die sich aber weniger auf gemeinsame kulturelle Werte und Austausch, sondern vielmehr auf ein pragmatisches wirtschaftliches Miteinander gründeten.
Durch die geopolitische Lage, die sich im Laufe des Ersten Weltkrieges und nach seinem Ende ergab, entstand für das Spannungsfeld zwischen China und Deutschland eine besondere, eine gegenseitige Annäherung begünstigende Situation:
Die Einnahme Kiaochows durch Japan nach zehnwöchiger Belagerung am 7. Nov. 1914 und die nach einer anfänglichen Neutralitätserklärung vom 6. Aug. 1914 auf Drängen der USA am 14. Aug. 1917 erfolgte Kriegserklärung Chinas an Deutschland legten zunächst zwar alle deutschen Kultureinrichtungen lahm (die von Missionen betriebenen allerdings nur mit Einschränkungen), erwiesen sich aber in der Folge als eine fast vorteilhafte Niederlage: Das Nachrücken Japans in die Positionen der ehemaligen deutschen Kolonialmacht, das durch den am 28. Juni 1919 von China endgültig abgelehnten Versailler Vertrag von den Westmächten sanktioniert wurde, brachte China und Deutschland als gemeinsame Verlierer nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch kulturell näher. Der offiziellen Erklärung der Beendigung des Kriegszustandes zwischen den beiden Ländern durch Präsident Wilson (Sept. 1919) folgte am 20. Mai 1921 das deutsch-chinesische Abkommen, das als erster Vertrag mit einer europäischen Macht auf den Grundsätzen der völligen Gleichstellung beruhte. (Grimm/Bauer 1974: Sp. 252)
In Chinas Augen wurde Deutschland so in einer Art Umkehrung der kolonialen Geschichte zu einem Modellfall, wie die Beziehungen zu westlichen Nationen in der Zukunft ausgestaltet werden könnten. Hier bestanden Chancen auch zu mehr interkulturellem Austausch mit den in China präsenten Deutschen. Deutschland verfolgte dennoch eigene wirtschaftliche Ziele und wollte weiter in China Handel treiben können:
Die Vertreter der deutschen Chinawirtschaft wollten […] nichts von größeren Kompromissen, Zugeständnissen und Rücksichtnahmen in China wissen. Keinesfalls sollten die „legitimen Ansprüche“ – z. B. auf ein Niederlassungsrecht – aufgegeben werden, wie es der Ostasiatische Verein in einer Stellungnahme zu einer Denkschrift der Deutsch-Chinesischen Verbandes über „Friedensziele in China“ formulierte […]. (Ratenhof 1987: 283)
Schmitt-Englert (2012) illustriert in ihrer Studie, die auf in der Zeit zwischen 1920 und 1950 in China lebende Deutsche fokussiert, dass es verschiedene Zentren gab, an denen Deutsche angesiedelt waren. Hierbei geht sie jeweils ausführlich auf Shanghai, Tianjin und Beijing ein und inkludiert auch Aspekte zum Alltagsleben. Allerdings gibt es in ihrer Studie keine explizite Kommunikation mit den Chinesen thematisierende so benannte Abschnitte. Aus Umfangsgründen kann in der vorliegenden Studie nicht näher auf die Lebensumstände der deutschen Population in diesen Städten während dieser Zeit eingegangen werden. Szurawitzki (i.V.) betrachtet am Beispiel der Shanghaier Publikation Gelbe Post zu Zeiten jüdischer Immigration auf der Flucht vor den Nationalsozialisten Werbekommunikation für und durch Flüchtlinge, deren Identitäten sich teils auch in der Werbung spiegeln. Insgesamt stellen diachrone linguistische Studien zur Kommunikation v. a. in der Shanghaier Diaspora ein übergreifendes Desiderat in der Forschung dar. Hierzu ließen sich geeignet u. a. die digitalen Archive des Leo Baeck Institutes1 nutzen, die v. a. für Shanghai Tausende Digitalisate enthalten.
Zurück zu den größeren wirtschaftlich-politischen Linien der Zeit: Mit Blick auf spätere Geschäftstätigkeit hatten deutsche Handelskreise Japan signalisiert, keine Ansprüche auf die Kolonialgebiete um Qingdao zu erheben, um später vielleicht in den Genuss von wirtschaftlichen Vorteilen zu gelangen (Ratenhof 1987: 283). Diese Vorstellungen sollten sich zunächst aber in der Praxis nicht umsetzen lassen, die Geschäfte liefen nicht vergleichbar gut wie vor dem Krieg (Ratenhof 1987: 284-286). Erst gegen Mitte der 1920er Jahre konnten in den Ausfuhren nach China, aber auch nach Japan, die besten Vorkriegsjahre übertroffen werden (Ratenhof 1987: 291). Dennoch achtete die deutsche Wirtschaft darauf, dass auch kulturelle und auf Kommunikation setzende Projekte forciert wurden, hierbei vor allem der Wiederaufbau der 1907 in Shanghai mit deutschen Mitteln eingerichteten Tongji-Universität (Ratenhof 1987: 296; vgl. hierzu auch 2.6. unten). Ein zentrales Interesse zur Anknüpfung an alte wirtschaftliche Erfolge sollte der Rüstungsindustrie (vgl. oben) zukommen:
Über die Wiederaufnahme rüstungswirtschaftlicher Beziehungen und guter Verbindungen zum chinesischen Militär in China [sic] hoffte sie [die deutsche Chinawirtschaft; MSZ], die Geschäftsgrundlage langfristig stabilisieren zu können. Die Industrie blickte hierbei bereits seit Anfang der 20er Jahre vor allem nach Südchina. Die Kuomintang-Gegenregierung in Canton schien die beste Aussicht zu bieten, China zu einigen und die Modernisierung auch zum Vorteil der deutschen Wirtschaft fortzuführen […]. (Ratenhof 1987: 299)
Politisch erwies sich die Umsetzung von Geschäften mit Rüstungsgütern mit der Kuomintang aber als schwierig, einerseits aus den Regelungen des Versailler Vertrags, andererseits aus politischen Vorbehalten heraus (vgl. Ratenhof 1987: 306). Es wurde zunächst der Handel mit relevanten Ersatzteilen wieder angeschoben, insgesamt konnte aber nicht an die Situation der 1870er Jahre angeknüpft werden:
Die Hoffnungen der deutschen Industrie, wieder stärker ins chinesische Rüstungsgeschäft einzudringen, konnten trotz der „laissez-faire“-Haltung der Reichsregierung gegenüber deutschen Beratern und Technikern in China […] nur teilweise erfüllt werden. Obwohl die Chinesen deutsches Rüstungsmaterial äußerst schätzten, blieb die Situation der Rüstungswirtschaft auf dem chinesischen Markt in noch weit größerem Maße […] unbefriedigend. (Ratenhof 1987: 310)
Читать дальше