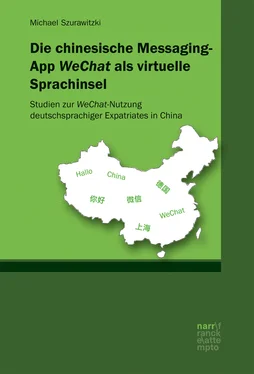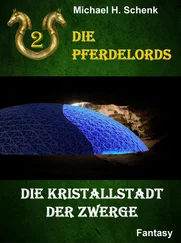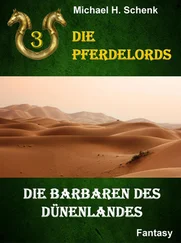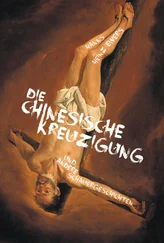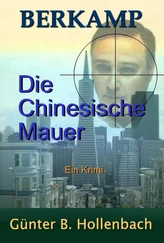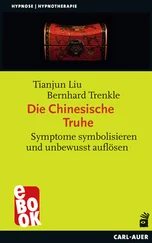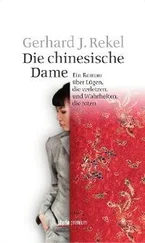Der in Tianjin residierende Kanzler Li Hongzhang (1823–1901), der 1896 als Kaiserlicher Bevollmächtigter gemeinsam mit seinem deutschen Berater Gustav Detring (1842–1913) Russland, Europa und Amerika besuchte, war eher deutschfreundlich eingestellt und sah in Deutschland in Bezug auf Waffentechnik, militärische Organisation und Schulung von Soldaten ein Vorbild für China. Er sah darin wohl auch die Chance, durch eine Balance innerhalb des Landes, die westlichen Mächte gegeneinander auszuspielen. Gustav Detring fungierte zwischen 1877 und 1905 als chinesischer Seezolldirektor in Tianjin und hatte als Berater Li Hongzhangs dessen pro-deutsche Einstellung sicher mit beeinflusst. Mit Hilfe des früheren Generalgouverneurs von Zhili und späteren Kanzlers Li Hongzhang war es Deutschland gelungen, seine wirtschaftlichen Beziehungen zu China zu verbessern, denn – so die Auffassung des Historikers Ding Jianhong – Li war nicht nur ein Bewunderer Bismarcks, er war ebenso überzeugt von der Überlegenheit deutscher Waffentechnik. Abgesehen davon hegte er auch die Hoffnung, die in China vertretenen westlichen Mächte in gegenseitigen Rivalitäten zu binden und damit China einen Vorteil zu verschaffen. Die Waffengeschäfte deutscher Unternehmen, an ihrer Spitze die Firma Krupp, hatten Mitte der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts einen Höhepunkt erreicht. Um diese Zeit war China der größte ausländische Abnehmer deutscher Rüstungsgüter geworden. (Schmitt-Englert 2012:39)
Nach Grimm/Bauer (1974) prägte die daraufhin eingegangene Handelskooperation zur Realisierung politischer Ziele in beide Richtungen (hier wird sukzessive erstmals eine eher auf Augenhöhe geführte Kommunikation wichtiger) das Bild des jeweils anderen Landes wohl nachhaltiger als vielerlei kultureller Austausch:
Es gehört zu den ungern wahrgenommenen Tatsachen in den deutsch-chinesischen Beziehungen, daß Waffengeschäfte und Militärexpertisen in Verbindung mit Fleiß, technischem Können und Ordnungsliebe das Bild des Deutschen in China mehr geprägt haben als kulturelle Errungenschaften. Auch umgekehrt muss festgehalten werden, daß es die autoritären Züge der chinesischen politischen Kultur gewesen sind, die das deutsche Bewußtsein von China mehr als solche revolutionärer Art bestimmt haben, und zwar seit der Taiping-Revolution1 [1851-1864; MSZ] bis 1949. (Grimm/Bauer 1974: Sp. 246)
In jedem Fall zeigte sich eine schnell ansteigende geschäftliche Aktivität von Deutschen in China:
Schon bald nach der Niederschlagung des Taiping-Aufstandes bewirkte die Öffnung des Suez-Kanals 1869 einen gewaltigen Schub im deutschen Chinahandel. 1877 waren bereits 41 deutsche Firmen in China vertreten, von denen sich 17 in Shanghai niedergelassen hatten. Entsprechend war die Zahl der Deutschen auf 414 angewachsen. Eine andere Quelle geht gar von 45 deutschen Unternehmen im Jahr 1876 mit 326 Deutschen aus, über die Hälfte davon (26 Niederlassungen und etwa 200 Deutsche) in Shanghai. Damit stand Deutschland an dritter Stelle hinter England (226 Firmen, 1611 Engländer) und Amerika (45 Firmen, 536 Amerikaner), aber vor Frankreich (10 Firmen, 298 Franzosen). In den Folgejahren überstieg die Anzahl der deutschen Niederlassungen sogar die Zahl der amerikanischen. Aus einer Statistik des Jahres 1897 geht hervor, dass Deutschland mit seiner wirtschaftlichen Präsenz von 104 Firmen und 950 Personen an zweiter Stelle hinter Großbritannien (374 Firmen, 4929 Personen) und vor den USA (32 Firmen, 1564 Personen) und Frankreich (29 Firmen, 50 Personen) angesiedelt war. (Schmitt-Englert 2012:37)
Mit der längerfristigen Ansiedlung deutscher Arbeitskräfte an Standorten wie Shanghai, über deren Kommunikation untereinander (auch mit Blick auf die Interaktion mit den Chinesen) wir heute kaum etwas wissen, da zu wenig Zeugnisse erhalten sind, ging zwangsläufig auch mehr Kommunikation zwischen Deutschen und Chinesen einher, auch wenn sich diese oft auf den Bereich des täglichen Bedarfes an Gütern beschränkt haben dürfte (Schmitt-Englert 2012, Kap. 1.2., beschreibt das Shanghaier Pidgin der dort ansässigen Ausländer). Den deutschen imperialistischen Vertretern wird ähnlich wie ihren britischen und französischen Pendants „herrisches Auftreten und de[r] Gebrauch von Machtworten“ (Grimm/Bauer 1974: Sp. 247) attestiert. Hernig (2016) geht in seiner Einschätzung weiter:
Die Truppen des deutschen Kaisers benahmen sich in China so schlecht wie alle anderen ausländischen Militärs. Tausende von chinesischen Aufständischen starben durch deutsche Gewehre bei der Niederschlagung des Boxeraufstands von 1900, der sich gegen die christlichen Missionare und die Ausbeutung Chinas durch die laowai 2 richtete, unzählige Zivilisten mussten bluten. In seiner berüchtigten „Hunnenrede“ hatte der deutsche Kaiser Wilhelm II. gegen die chinesischen „Untermenschen“ gewütet: Die sollten es nicht wagen, einen Deutschen auch nur „scheel“ anzusehen. (Hernig 2016: 105; Hervorhebung i.O.)
Dies zeigt weiter eine denkbar große Ungleichheit der kommunikativen Voraussetzungen zwischen Deutschsprachigen und Chinesen im Reich der Mitte bis dahin. Eine zu allem entschlossene Handlungsweise der deutschen Kolonialmacht hatte sich schon nach den Ereignissen manifestiert, die mit der oben erwähnten Ermordung zweier Steyler Missionare ihren Anfang nahmen.
Mühlhahn (2007) beschreibt kompakt die Entwicklungen zur Einrichtung der deutschen Kolonie „Kiautschou“ im Nordosten Chinas mit dem Zentrum Qingdao und ihre Geschichte:
Am 1. November 1897 ermordeten Mitglieder einer antichristlichen Kampfgruppe in der nordchinesischen Provinz Shandong zwei deutsche Missionare. Dies diente der deutschen Regierung als Vorwand, das damalige Dorf Qingdao an der Jiaozhou-Bucht von deutschen Marineeinheiten am 14. November 1897 besetzen zu lassen. Nach längeren Verhandlungen erfolgte am 6. März 1898 die Unterzeichnung eines Vertrages mit China, in dem das Gebiet um die Bucht (von den Deutschen „Gouvernement Kiautschou“ genannt) auf 99 Jahre an Deutschland verpachtet wurde und dem Deutschen Reich Rechte zur Errichtung zweier Eisenbahnlinien und zur Anlage von Bergwerken in Shandong zugesichert wurden. Doch statt 99 Jahre währte die deutsche Kolonialzeit nur 17 Jahre. Kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges in Europa stellte Japan im August 1914 dem Deutschen Reich ein Ultimatum, Kiautschou bedingungslos zu räumen. Nach Kämpfen im September und Oktober kapitulierte die Kolonie am 7. November 1914. (Mühlhahn 2007: 43)
In der Rückschau werden die Lebensbedingungen in Kiautschou in einer durch geographische, rechtliche und auch kulturelle Segregation geprägten Ordnung – weiter ohne eine auf gegenseitigem Austausch basierende Kommunikation (hierzu wissen wir ingesamt viel zu wenig Gesichertes, anders als für andere Orte; vgl. Schmitt-Englert 2012) – von Mühlhahn folgendermaßen rekonstruiert:
[D]er chinesischen Bevölkerung war es verboten, innerhalb des europäischen Teiles von Qingdao zu wohnen. Für die chinesische Bevölkerung galt außerdem eine völlig andere Rechtsordnung, die sich hinsichtlich der Strafformen (zum Beispiel Prügelstrafe) überwiegend an dem traditionellen chinesischen Recht orientierte. Für die europäische Bevölkerung galt hingegen das ,moderne‘ Recht des Deutschen Reiches. Im Ergebnis wurden für ein und dasselbe Delikt gegen einen Chinesen ein anderes Strafmaß und andere Strafformen verhängt als gegen einen Deutschen. Neben dem Aufbau einer umfassenden Verwaltung kam es in Qingdao also zur konsequenten bürokratischen Umsetzung und Normalisierung einer Rassenideologie. Dem Zweck der auf dem Verordnungswege durchgesetzten und kontrollierten Absonderung dienten vielfältige, sorgsam durchdachte Entscheidungen und Aktionen der Verwaltung, wie die genannte strikte Trennung der chinesischen und deutschen Wohngebiete und die unterschiedlichen Gesetze für Deutsche und Chinesen. Die Rassentrennung wurde erst in den letzten Jahren der Kolonie ab 1910 gelockert. Die Verwaltung kam damit wachsender Kritik der chinesischen Bevölkerung an der Rassentrennung nach. (Mühlhahn 2007: 44-45)
Читать дальше