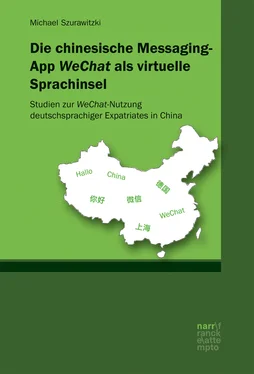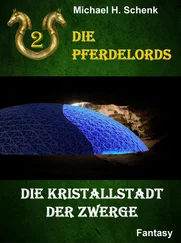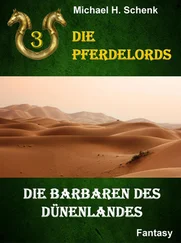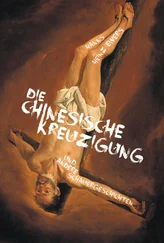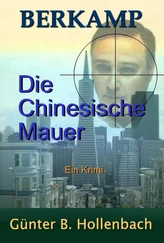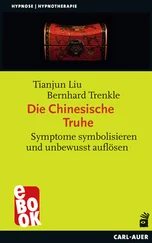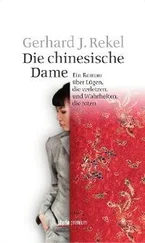Wird mehr an Schriftlichkeit oder Mündlichkeit orientiert geschrieben?
Die vorliegende Studie versteht sich als medienlinguistischer Forschungsbeitrag einerseits und als Beitrag zu einer china-orientierten, auch interkulturell orientierten Germanistik andererseits. Mit der Fokussierung auf den Messenger WeChat bekommt die Studie eine eigene, distinktive Perspektive, da eine Verbindung der deutsch-chinesischen interkulturellen Medienlinguistik so in der einschlägigen Forschung nach meiner Kenntnis noch nicht erfolgt ist. Ebenso setzt sich der hier gewählte Zugriff von den in Zhang [et al.] (2020) formulierten Positionsbestimmungen einer schwerpunktmäßig US-basierten Forschungsrichtung, den Asian German Studies , ab und sucht mehr den Anschluss an die Diskurse in der Medienlinguistik im deutschen Sprachraum und in die entsprechend relevanten kontrastiven Auffächerungen.
Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Monographie ist auf der Basis des bisher Gesagten folgendermaßen aufgebaut: Nach der vorliegenden Einleitung (1.) steht zur Einbettung in den historisch-diskursiven Kontext ein Kapitel zur Geschichte des deutschsprachigen Engagements in China (2.). Daran schließt sich eine kompakte Bestandsaufnahme des deutschsprachigen Engagements in China heute an (3.). Die Kapitel 2. und 3. können m.E. zeigen, dass historisch wie heute die Deutschsprachigen und das Deutsche in China eine relevante Rolle spielten bzw. spielen. Daraus leitet sich auch die Notwendigkeit einer Untersuchung wie der hier durchgeführten ab. Hieran anschließend wird der Forschungsstand zu WeChat in den Blick genommen (4.). Im fünften Kapitel wird WeChat mitsamt seiner Möglichkeiten als Kommunikationstool näher betrachtet. Danach fokussieren wir auf die zur Datenerhebung verwendete Methode, nämlich auf die Online-Umfrage (6.): Dieses Kapitel umfasst eigene Abschnitte zum Umfragedesign, zum durchgeführten mehrphasigen Pretest, den daraus erwachsenden Modifikationen und der finalen Genese der Online-Umfrageerhebung mit ihren Desktop- und Smartphoneversionen. Der letzte behandelte Punkt innerhalb dieses Kapitels thematisiert den Erhebungszeitraum und die Verbreitung des Umfragelinks.
Danach folgt der empirische Teil der Studie (7.), in dem die Ergebnisse einer Online-Erhebung, die zwischen November 2018 und April 2019 durchgeführt wurde, zur Nutzung von WeChat durch deutschsprachige Expatriates in China sowie Alumni in ihrer virtuellen Sprachinsel dargestellt werden. In diesem Zusammenhang werden mit Blick auf die Forschungsfragen dabei die folgenden Bereiche betrachtet: Die erhobenen Metadaten zu den NutzerInnen, der Kontakt zu WeChat und die parallele Nutzung anderer Messaging-Applikationen, die Häufigkeit der WeChat -Nutzung, die Nutzung der einzelnen Features der WeChat -App, die innerhalb der WeChat -Kommunikation genutzten Sprachen und Sprachmischungsphänomene, Aspekte der Sprachrichtigkeit, Deutsch und Chinesisch im Austausch mit der jeweils anderen Kultur, die Übersetzungsfunktion von WeChat , die Verwendung von Internetsprache, das Spannungsfeld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit sowie abschließend freiwillige Kommentare zur Nutzung von WeChat .
An die empirische Auswertung schließt sich eine Zusammenfassung mit Ausblick an (8.), die die Studie perspektiviert und verortet. Danach wird in einem gesonderten Abschnitt zum Forschungsdatenmanagement angegeben, wo und wie die erhobenen Daten für weitere potenzielle Analysen öffentlich zugänglich elektronisch archiviert sind (9.). Am Ende stehen zwei Anhänge: Zunächst ist der genutzte Fragebogen abgedruckt, danach steht ein Anhang, in dem alle Auswertungen, die im Kapitel 7. vorgenommen wurden und dort als Grafiken dargestellt sind, in tabellarischer Form gegeben werden.
2. Deutschsprachiges Engagement in China historisch
Die vorliegende Darstellung der historischen Entwicklung des deutschen Engagements in China1 unternimmt erst gar nicht den Versuch, vollumfänglich nachzuzeichnen, wie sich Deutschland und China kulturell und politisch annäherten. Dennoch wird versucht – gestützt auf geeignete sinologische Literatur (für eine Entwicklung der Sinologie in den westlichen Staaten vgl. Franke 1974), zumeist aus dem deutschsprachigen Raum –, einen Einblick zu vermitteln, der zeigt, dass es bereits jahrhundertelang Kontakt zwischen Deutschsprachigen und Chinesen auf chinesischem Boden gibt und es dabei sehr unterschiedliche Phasen gegeben hat. Der Hintergrund eines solchen Vorgehens ist, aufzuzeigen, dass einerseits viel Kontakt bestand/besteht, andererseits eine aus moderner Sicht als vielleicht ,gleichberechtigt‘ zu bezeichnende Kommunikation trotz des existierenden Austausches eher selten war/ist. Heute in China sesshaften Deutschsprachigen mag überhaupt nicht (mehr) bewusst sein, dass sie nicht eine erste Generation in der Fremde darstellen, obwohl man in der Beobachtung der deutschsprachigen Expatriate-Gruppierungen im Reich der Mitte manchmal den Eindruck gewinnen kann, als fühlten sich diese trotz der Möglichkeiten, die moderne Medien – Messenger wie WeChat eingeschlossen – zur Information auch vorab bieten, als ,Pioniere‘ und erste Gäste in einer Kultur, die der heimischen so völlig fremd ist. Obwohl WeChat ein chinesischer Messenger ist, kann er, so paradox es klingt, durch die Kommunikation, die einer ,Blase‘ von Expatriates durch ihn ermöglicht wird, dazu beitragen, dass China mit seiner vielfältigen und alten Kultur für die auch digital unter sich Agierenden weitestgehend fremd bleibt. Man kann den sich ohne Zweifel manifestierenden Fremdheitseindruck in der heutigen Zeit vielleicht nachvollziehen, es dürfte jedoch schwerfallen, zu rekonstruieren, wie die Protagonisten während der ersten Kontakte zwischen dem deutschsprachigen Kulturraum und China sich gefühlt haben müssen. Ausgehend von der Darstellung im China Handbuch (Franke/Staiger 1974) werden folgende Schritte in chronologischer Reihenfolge in den Blick genommen: Zunächst steht ein Abschnitt zur christlichen Mission (2.1.), nach dem die politischen Beziehungen, speziell die kolonialen Bestrebungen des Deutschen Reiches in China, im Fokus sind (2.2.). Hiernach wird die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen betrachtet (2.3.), in der sich Deutschland und China als ,Benachteiligte‘ nahestanden. Die NS-Zeit und der Zweite Weltkrieg forcieren einen Niedergang in den Beziehungen der beiden Länder, der sich nach der deutschen Teilung und der internationalen Isolation Chinas fortsetzt (2.4.). Ab den späten 1970er Jahren markiert die Öffnungspolitik (2.5.) einen prinzipiell bis heute anhaltenden Aufschwung und eine nachhaltige Wiederaufnahme der Relationen. Die zu WeChat befragten deutschsprachigen Expatriates sind auch aufgrund der Entwicklungen in China seit dieser Zeit. Zur Öffnungspolitik gesellt sich eine parallel beginnende Stärkung der deutschen Sprache und Germanistik in China, auf die in einem das Kapitel beschließenden Exkurs eingegangen wird (2.6.).2
Den Beginn der kulturellen Kontakte zwischen dem deutschsprachigen Raum und China markierte die über Jahrhunderte aktive1 christliche Mission (für einen Gesamtüberblick und weiterführende Literatur vgl. Kramers 1974), die schon kurz nach 1300 nachweisbar ist. Hierbei war das angestrebte Kommunikationsziel natürlich eine Bekehrung einer möglichst großen Anzahl Chinesen zum christlichen Glauben. Ich stütze mich in meiner Darstellung auf den Handbuchartikel von Grimm/Bauer (19742), die Folgendes feststellen:
Der erste in China nachweisbare deutsche Missionar, ein Franziskanermönch namens „Bruder Arnold“ aus der kölnischen Provinz, predigte 1303 im heutigen Peking. Nur wenig später wurde erstmalig auch der Name Deutschlands notiert: als A-lu-mang-ni-a auf der etwa 1330 erschienenen Weltkarte des Li Tse-min. (Grimm/Bauer 1974: Sp. 250; Hervorhebungen i.O.)
Читать дальше