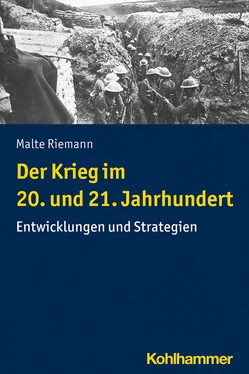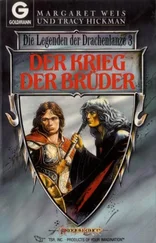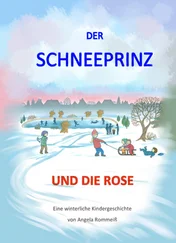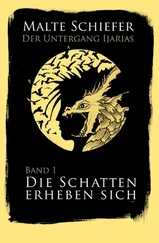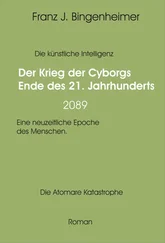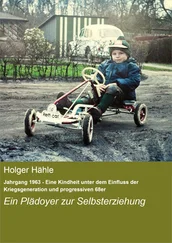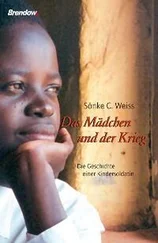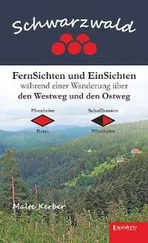1) Satelliten erlauben, wie oben angemerkt, die Überwachung des Gefechtsgebietes und bieten somit dem Militär einen Informationsvorteil.
2) Der zweite Nutzen bezieht sich auf militärische Gegenmaßnahmen zu dieser Aufklärung. Sogenannte antisatellite capabilities zielen darauf ab, gegnerische Satelliten zu stören oder zu zerstören. Das Stören oder Zerstören kann auf unterschiedliche Weisen, welche zum Teil auch außerhalb des Weltraums stattfinden, erreicht werden. So kann z. B. die Kommunikationslinie zwischen Satelliten und Bodenstationen unterbrochen oder Bodenstationen oder Satelliten zerstört werden. Die Mittel hierfür können von elektronischer Kriegsführung, die die Kommunikationswege stört oder Störungen verursacht, Angriffen auf erdgebundene Anlagen, die Verwendung von Antisatellitenwaffen, die mit Sprengkörpern ausgerüstet gegnerische Satelliten zerstören, und Hochfrequenzwaffen bis zu gezielten Energiewaffen (Lasern), dem Ändern von Umlaufbahnen, umso Satelliten mit anderen Satelliten zu rammen, oder dem Einsatz von Atomwaffen reichen. (Lupton 1998)
3) Der dritte Nutzen ergibt sich aus im Weltraum stationierter Waffensysteme (space-to-earth weapons), welche Angriffe auf Bodenziele aus dem All ermöglichen. Diese sind jedoch größtenteils noch in der Entwicklungsphase, und deren militärische Vorteile sind umstritten. (DeBlois 2004) Trotz dieser Militarisierung des Weltraums wurde der Krieg bisher noch nicht in das All hineingetragen.
»Die gegen Weltraumziele gerichtete Kriegsführung hat bislang ebenso wenig stattgefunden wie der Einsatz im Weltraum stationierter Waffen gegen terrestrische Ziele.« (Hansel 2010, S. 261) In den letzten Jahren hat sich die Gefahr dessen jedoch erhöht. So hat die NATO 2019 den Weltraum als separate Domäne für militärische Operationen anerkannt und Präsident Trump 2018 den Aufbau einer Space Force in Auftrag gegeben. Dies könnte zu einem neuen Wettrüsten im Weltraum führen.
Eine Betrachtung des Krieges kann die Kriegsfolgen nicht ignorieren. Dem Krieg folgen Tod, Leid und Zerstörung. Da Kriegsfolgen weitreichend sind, sollen im Folgenden drei Dimensionen untersucht werden. Hierbei wird eine Einschränkung in gesellschaftliche, politische und ökonomische Kriegsfolgen unternommen. Diese unterschiedlichen Dimensionen sind oft eng miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig.

Abb. 2a: Dresden. Blick vom Rathausturm nach Süden mit der Allegorie der Güte (auch: Bonitas; Skulptur von August Schreitmüller, entstanden 1908/1910), Aufnahme von 1945.
Gesellschaftliche Kriegsfolgen
Die Auswirkungen des Krieges auf die Gesellschaft sind vielfältig. Am offensichtlichsten treten bei einer Betrachtung der gesellschaftlichen Kriegsfolgen zunächst die Opfer ins Auge. Der Krieg verletzt, verstümmelt und tötet unzählige Menschen. Die Kriegsopfer des Zweiten Weltkrieges werden auf über 60 Millionen geschätzt. Hierbei lässt sich vor allem seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts feststellen, dass der Anteil von Zivilopfern zunimmt. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz schätzt den Anteil von Zivilopfern während des Ersten Weltkrieges auf 5 Prozent, während dessen Anteil gegen Ende des 20. Jahrhunderts auf 90–95 Prozent gestiegen ist. Laut Mary Kaldor ist die Wahrscheinlichkeit eines gewaltsamen Todes im Krieg heutzutage achtmal höher für die Zivilbevölkerung als für Angehörige der kriegsführenden Parteien.

Abb. 2b: Die Altstadt von Frankfurt nach den schweren Bombardements durch Alliierte. Luftbild von Juni 1945.
(Kaldor 2002) Neben zahlreichen Todesopfern führt der Krieg auch zu Flucht und Vertreibung. Der Krieg hat darüber hinaus weitreichende Auswirkungen auf das Gesundheitswesen. Hierbei ist zwischen physiologischen und psychologischen Folgen zu unterscheiden. Bezüglich der physiologischen Folgen lässt sich zunächst feststellen, dass Kriege oft zu einer Notfallsituation bei der humanmedizinischen Versorgung führen. Krankenhäuser werden zerstört oder sind durch den plötzlichen Anstieg an Verletzten und Verwundeten überlastet. Erschwert wird diese Situation oftmals durch den Ausbruch von Infektionskrankheiten, die aufgrund der mangelnden Gesundheitsversorgung schnell endemische Ausmaße annehmen können. Darüber hinaus führt der Krieg oft zu einem Zusammenbruch der pharmazeutischen Versorgung, was einen Mangel an Medikamenten und Impfstoffen zu Folge hat, was ebenfalls den Ausbruch von Infektionskrankheiten begünstigt. Häufig ist eine vom Krieg betroffene Bevölkerung auch der Unterernährung ausgesetzt, da Landwirtschaft und Handel zum Erliegen kommen. Auf die körperliche Gesundheit bezogen lässt sich allgemein feststellen, dass in Zeiten des Krieges die Lebenserwartung sinkt. Der Krieg hat neben den Auswirkungen auf den Körper auch folgenschwere Auswirkungen auf die Psyche. Die Schrecken des Krieges führen zu Depression und Trauma. Posttraumatischen Belastungsstörung sind die Folge. Von diesen psychologischen Begleiterscheinungen des Krieges sind sowohl Zivilbevölkerung als auch Kombattanten betroffen. Außerdem hat die moderne Kriegsführung weitreichende ökologische Folgen. Während des Vietnamkrieges z. B. versprühten die USA über 70 Millionen Liter Entlaubungsmittel, um die Nachschubrouten der nordvietnamesischen Armee, die sogenannten Ho-Chi-Minh Pfade, sichtbar zu machen. Dies zerstörte ca. 15 Prozent des vietnamesischen Ökosystems. Nach dem Ende des Krieges wurden diese Gebiete neu besiedelt und seitdem zeigt sich in diesen Gebieten eine auffällig hohe Anzahl an Fehlgeburten.

Abb. 3: Vietnamkrieg, flüchtende Mutter mit Kindern.
Auch die politischen Kriegsfolgen sind vielfältig. Zunächst haben Kriege oft maßgeblichen Einfluss auf die Regierungsstrukturen eines Staates. In demokratischen Systemen kann ein von der Bevölkerung nicht hinreichend unterstützter Krieg zu einem Regierungswechsel führen. Kriege führen aber auch zu einem extern aufgezwungenen Wandel in der Regierungsform, wie etwa in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Neben einem Wandel der Regierungsform kann der Krieg auch zur Herausbildung neuer Staaten führen. So entstand Jugoslawien etwa nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Zerfall Österreich-Ungarns und zerfiel dann selbst zwischen 1991 und 2006 in verschiedene Staaten (Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Slowenien). In seinem seminalen Werk Coercion, capital, and European states, AD 990–1992 (1992) geht der amerikanische Historiker Charles Tilly sogar so weit, zu behaupten, dass der Krieg im Kontext der europäischen Geschichte den Staat erst schafft. Nach Tilly führt der Krieg durch die Wechselwirkungen von vier Prozessen zur europäischen Staatenbildung:
1) Kriege, die in der Ausschaltung lokaler Rivalen wie etwa Prinzen, Baronen und anderen lokalen Machthabern gipfelten, führten zu einer Zentralisierung der Staatsmacht und der Einrichtung eines weitreichenden Gewaltmonopols.
2) Dieses Gewaltmonopol des Staates wurde zunehmend ausgeweitet und führte zur Bildung von Polizeikräften.
3) Kriegsführung und militärische Expansion wären nicht möglich, ohne der Bevölkerung Ressourcen zu entziehen und Kapital zu generieren. Dies führte zur Einrichtung von staatlichen Bürokratien, um Soldaten aus der eigenen Bevölkerung zu rekrutieren und Steuern zu erheben.
Читать дальше