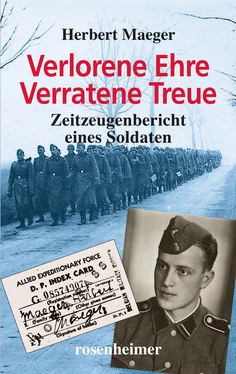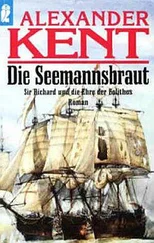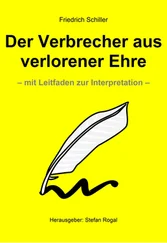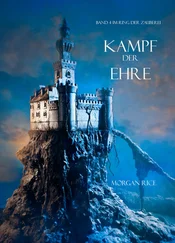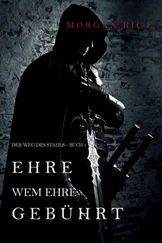Die Schule ging zunächst weiter wie vordem. Einige Lehrer waren nicht mehr da, darunter unser beliebter und auch von mir verehrter »Klassen-Prof« der Unterprima, Professor Bernard. Der Unterricht wurde mehr schlecht als recht fortgesetzt; ich war auch sehr in Anspruch genommen durch das Geschehen um uns herum. Feldgraue Kolonnen marschierten, es gab Einquartierung, im Tunnel bei Hergenrath stand ein riesiges Eisenbahngeschütz, das aus seiner Deckung in regelmäßigen Zeitabschnitten herausgefahren wurde und dröhnende Schüsse auf die starken belgischen Forts bei Lüttich abgab.
Ich war ständig mit dem Fahrrad unterwegs, um nichts zu versäumen, war als Erster bei einem schwer verwundeten und notgelandeten deutschen Jägerpiloten und verbrachte viel Zeit bei den Soldaten einer Stellung der schweren Flak an der Eisenbahnstrecke. Dabei machte ich ungehindert Fotos und verdiente mir meine ersten Zeitungshonorare. Neben der gesprengten Hergenrather Eisenbahnbrücke waren die ersten Motive deutsche Soldaten bei einer Marschpause und ein abgeschossenes belgisches Jagdflugzeug.
Im Juli kamen die großen Ferien und für das Collège Patronné das vorläufige Ende. Das neue Schuljahr begannen wir in der »Oberschule für Knaben«, für uns Oberklässler allerdings auslaufend mit dem humanistischen Gymnasial-Lehrprogramm. Um uns die Rückständigkeit des belgischen Schulsystems zu beweisen, servierte man uns – die wir bis dahin Mathematik nur als philosophisch-logische Denkschulung kannten – technisch angewandte Mathematik, so zum Beispiel die grafische Darstellung der Phasenverschiebung eines Drehstrommotors. Damit wurde ich ganz gut fertig, besser als mit dem Klima an der deutschen Schule, das man als »vormilitärisch« bezeichnen könnte. Anders als in Belgien, wo ein klares Punktsystem nachweislich die Leistungen der Schüler bewertete, hing bei der deutschen Schule alles von der subjektiven Einschätzung der Lehrer ab. Ich war nie ein Opportunist: Das Zeugnis zu meinem Abitur im Frühsommer 1941 fiel entsprechend unausgewogen aus. Das belgische Gymnasium hatte mir alles in allem besser gefallen.
Schon kurze Zeit nach dem deutschen Einmarsch wurden die deutschen Behörden eingerichtet, bereits im Juni wurden wir durch »Führererlass« Deutsche, genauer gesagt »deutschen Staatsbürgern gleichgestellt«. Das war eine Einbürgerung zweiter Klasse, »Reichsbürger« waren wir noch nicht. Die »Heimattreue Front«, die schon früher illegal tätig gewesen war, bildete die Kader für die nationalsozialistischen Organisationen, die Mitgliedschaft in der Hitler-Jugend wurde obligatorisch. Ich machte den Dienst gerne, eignete mir aus Organisationsbüchern bald das theoretische Wissen an und wurde nach wenigen Monaten in Walhorn HJ-Kameradschaftsführer. Das Dienstprogramm war nicht viel anders als bei den Pfadfindern, denen ich in Belgien angehört hatte; das Schwergewicht lag bei sportlicher Ertüchtigung.
Im Herbst 1940 wurde bei uns Oberprimanern in der Schule für die Marinearzt-Laufbahn geworben, Voraussetzung war die Freiwilligen-Meldung für den Kriegsdienst. Ich hätte die Gelegenheit, die ich als Chance ansah, gerne wahrgenommen, aber mein Vater verweigerte seine Unterschrift, die ich als Minderjähriger benötigte. Kurz darauf, Ende 1940, wurde ich in Eupen zur Musterung befohlen und für ein Artillerieregiment in Düsseldorf vorgemerkt. Dies hat nach dem Krieg eine Rolle gespielt, als ein belgisches Militärgericht mir anlastete, freiwillig als Angehöriger der Waffen-SS gegen die Sowjetunion gekämpft und damit sozusagen vorsätzlich die Waffen gegen Belgien getragen zu haben.
In dem Kampf um ihre »politische Rehabilitation« bemühten sich meine Eltern, den Vorwurf zu mildern, und fanden Unterstützung. Drei meiner langjährigen Klassenkameraden bescheinigten meinem Vater, dass ich zusammen mit ihnen und anderen Angehörigen des Jahrgangs 1922 in Eupen zur Zwangsmusterung befohlen worden war. Einer von ihnen, mit dem mich, seit wir uns in den siebziger Jahren wieder gefunden haben, enge Freundschaft verbindet, schloss sein Entlastungsschreiben mit den einfühlsamen Worten: »… ich will Ihnen von Herzen wünschen, dass Sie Herbert wieder sehen oder doch bald eine Nachricht von ihm erhalten«. Das war 1947, als meine Eltern seit mehr als zwei Jahren Verbindung mit mir hatten; aus wohl berechtigter Sorge hielten sie dies so weit wie möglich geheim.
Für meinen Vater gab es nach dem deutschen Einmarsch in Eupen-Malmedy 1940 eine Zeit der Unsicherheit. Er war 1920 vom deutschen in das belgische Beamtenverhältnis übergewechselt, hatte in Belgien dem Gemeinderat angehört und stand – das war bekannt – dem nationalsozialistischen Regime zumindest sehr reserviert gegenüber. Über Nacht wurde er zunächst problemlos wieder Reichsbahnbeamter in seiner bisherigen Position. Im Sommer 1941 wurde er nach Gemmenich versetzt, er wurde zwar dort auch Bahnhofsvorsteher, als eine Beförderung konnte man es kaum ansehen, denn der Ort hatte auch vor 1920 nicht zu Deutschland gehört, er war also ohne Grundlage annektiert worden; die Einwohnerschaft verhielt sich gegenüber den »Prüße«, zu denen außer uns zwei Lehrer und zwei Polizeibeamte gehörten, ausgesprochen eisig.
Mein Vater weigerte sich strikt, irgendeiner nationalsozialistischen Organisation beizutreten, nicht einmal zur Mitgliedschaft in der NSV (NS-Volkswohl fahrt) fand er sich bereit. Trotzdem wurde er, als Belgien von Eupen-Malmedy wieder Besitz ergriff, inhaftiert und musste einige Monate in einem Lütticher Gefängnis verbringen; ein Schicksal, das viele Eupen-Malmedyer mit ihm geteilt haben. Dabei musste der eine oder andere auch Schlimmeres erdulden: Meinem Vetter Lambert, der zur Deutschen Wehrmacht eingezogen worden war, wurde so zugesetzt, dass er ein Gelübde leistete, er wolle einem Missionsorden beitreten, wenn er heil nach Hause komme. Er war später 20 Jahre lang als Franziskanerbruder in Formosa. Es soll jedoch erwähnt werden, dass solche Erlebnisse Ausnahmen waren; niedrige Instinkte Einzelner, die es immer und überall gibt, finden in Ausnahmezuständen, wie es Kriege und Nachkriegszeiten sind, immer eine Gelegenheit, sich auszutoben.
Bedenklicheres als gegen meinen Vater lag nach dem deutschen Einmarsch in meine Heimat gegen meine Mutter vor. Eines Tages im März 1941 bestellte mich der NSDAP-Ortsgruppenleiter zu sich und eröffnete mir Folgendes: Mit meiner »politischen Haltung« sei man durchaus zufrieden, mein Vater und seine Beamtenstellung stünden jedoch in der Diskussion. Besonders »belastend« sei eine Äußerung meiner Mutter; diese habe am ersten Septembersonntag 1939, also unmittelbar nach Kriegsbeginn, in einem Gespräch mit drei anderen Frauen nach dem sonntäglichen Kirchgang den durch Zeugen schriftlich belegten Ausspruch getan: »Dieser Hitler ist doch ein Verbrecher!« Was ich als Faktum innerlich bestätigen musste, denn ich hatte den freimütigen Ausbruch meiner Mutter mitgehört und noch in allzu deutlicher Erinnerung.
Der Ortsgruppenleiter ließ mich wissen, dass dies eine schwer wiegende Sache sei, die man nur bei sehr großzügiger Behandlung ohne harte Konsequenzen regeln könne. Hilfreich sei dabei sehr, wenn ich mich freiwillig zur Waffen-SS melden und mein Vater dem zustimmen würde. Da ich ja bereits gemustert sei und vor meiner Einberufung stünde, sei das ja auch kein allzu schwerer Entschluss. Mit diesem Ergebnis der Unterredung und einem Formular für die Freiwilligen-Meldung ging ich nach Hause, sprach mit meinem Vater, und der unterschrieb – offensichtlich schweren Herzens. Und mir war auch nicht gerade wohl dabei.
Nach meinem Abitur Ostern 1941 verbrachte ich, meinem damaligen Berufswunsch folgend, noch einige Monate als Redaktionsvolontär beim »Westdeutschen Beobachter« in Eupen. Anfang September 1941 erhielt ich meinen Gestellungsbefehl zur »Leibstandarte Adolf Hitler«. Am 16. September stieg ich, knapp zwei Monate vor meinem 19. Geburtstag, in Aachen in den D-Zug nach Berlin. Meine Jugend war zu Ende, bevor sie eigentlich begonnen hatte.
Читать дальше