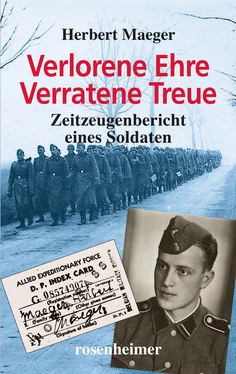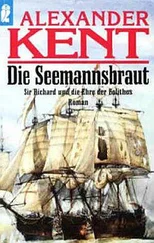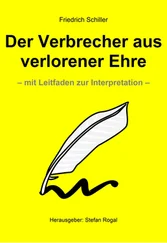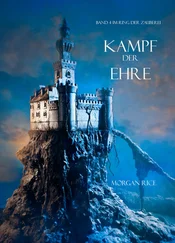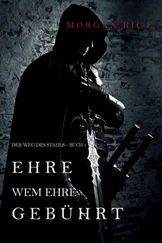Ich begann zu fragen und bekam von meinen Eltern karge Antworten, aus denen sich das politische Weltbild eines Kindes formte: Deutschland war das große Vaterland, aus dem wir vertrieben waren, Belgien das kleine, in dem wir leben mussten, weil das in einem Ort namens Versailles irgendwelche Leute mangelhaften Wissens oder Gewissens so bestimmt hatten. Sie hatten zwar entschieden, dass in Eupen-Malmedy eine Volksabstimmung stattfinden und die Einwohner selbst ihr Vaterland wählen sollten.
Diese Abstimmung hat im Sinne demokratischer Prinzipien nie stattgefunden. Irgendwann im Jahre 1920 wurde lediglich auf Plakaten verkündet, wer für Deutschland optieren wolle, müsse sich auf dem zuständigen Bürgermeisteramt melden und sich mit seiner Unterschrift in Listen eintragen. Dem war eine massive Einschüchterungskampagne vorangegangen. Nur wenige meldeten sich, die große Mehrheit hatte ganz einfach Angst – und in Deutschland herrschten Hunger und Not. Im engen Familienkreis hieß es, wer der Aufforderung zur Option nachkomme, werde in Handschellen über die Grenze nach Deutschland abgeschoben, sein gesamter Besitz konfisziert. Dies wird zwar von der offiziellen neueren Geschichtsdarstellung bestritten, bezeichnend ist jedoch: Nur 271 von den rund 60 000 Eupen-Malmedyern wagten sich für Deutschland zu entscheiden. *)
Mein Vater liebte sein Heimatdorf Hergenrath sehr und hatte dort von seinen Vorfahren Haus- und Grundbesitz. Beides wollte er wie fast alle anderen nicht verlieren, damit war das Ergebnis der Volksabstimmung, die in Wirklichkeit keine Wahl ließ, klar: Die Eupen-Malmedyer wurden »endgültig« Belgier und ihre Kinder auch. Ende der Zwanzigerjahre gab es eine inoffizielle Abstimmung der prodeutschen »Heimattreuen Front«, von der behauptet wurde, dass sie mit über neunzig Prozent zugunsten Deutschlands ausfiel. 1920 stimmte der eine oder andere auch mit den Füßen ab, verließ seine Heimat, ging nach Deutschland und baute sich »drüben« eine neue Existenz auf.
In der Praxis der neuen Verhältnisse stellte sich heraus, dass es eigentlich gar nicht so schlecht war, Belgier zu sein. Mein Vater, der wegen seiner Kriegsverwundung das Bäckerhandwerk im väterlichen Geschäft nicht mehr ausüben konnte und 1917 Bahnbeamter geworden war, wurde als Reichsbahn-Assistent von den Belgischen Staatsbahnen übernommen und bald, weil er sich in kurzer Zeit gute Kenntnisse im Französischen angeeignet hatte, Vorsteher des kleinen Bahnhofs Astenet; er trug eine schöne rote Mütze wie ein französischer General und war eine Respektsperson; schon in jungen Jahren wurde er Mitglied des Gemeinderats unserer Gemeinde Walhorn.
Überhaupt bemühten sich die Belgier, ihre Neubürger die dubiose Volksabstimmung vergessen zu machen, sie gaben ihnen – auch rückwirkend – alle Rechte: Mein Vater erhielt eine Kriegsrente, so als ob er für Belgien sein Blut vergossen hätte, und sogar einen belgischen Frontkämpferorden; er amüsierte sich ein bisschen darüber, hob ihn aber sorgfältig in der Schachtel auf, in der auch sein deutsches Eisernes Kreuz und sein Verwundetenabzeichen lagen.
Meine Heimat war stockkatholisch; die höchste Ehre, die einer Familie zuteil werden konnte, war, einen Priester in der Familie zu haben. Da mein Vater als ältester von drei Söhnen die elterliche Bäckerei übernehmen sollte, richtete sich dieser Ehrgeiz auf seinen Bruder Lambert, der als Theologiestudent 1916 in der Schlacht von Arras fiel. Sein Grab befindet sich in einem wunderschönen, gepflegten Soldatenfriedhof in Bapaume, einem kleinen Dorf im Tal der Somme. Er war im Priesterseminar Kommilitone meines Onkels Josef mütterlicherseits, damals als angehender Theologe ebenfalls der ganze Stolz seiner Familie. Von ihm wird noch die Rede sein; durch die Beziehung der beiden lernten sich meine Eltern kennen.
Neben der feierlichen Zelebration der ersten Messe eines jungen Priesters in seiner Heimatgemeinde – einer Primiz – war die jährliche Erstkommunion der Kinder das wichtigste Ereignis im Leben einer Gemeinde, das in den Familien der Bedeutung entsprechend gefeiert wurde. Dazu gehörte nach dem Besuch des Hochamts in der Pfarrkirche für alle Geladenen ein großes Festessen, das sich in einen ausgedehnten Nachmittagskaffee mit herrlichen Reis- und Obstfladen – rundes flaches, dick belegtes Hefeteig-Gebäck, wie man es von Breughels Gemälden kennt – fortsetzte und in das anschließende Abendessen, meist Kartoffelsalat mit Frankfurter Würstchen, überging. Am schönsten war es, wenn, wie bei meinem Hergenrather Onkel Martin und seiner von Herzen liebenswerten Frau Malchen, fünf Kinder im Haus waren, für die nacheinander die Feste ausgerichtet wurden.
Als ich zu diesem Alter heranwuchs, wurde ich in eine bedeutende Neuerung der kirchlichen Regel einbezogen. Vorher war üblich, die Erstkommunion verbunden mit der Firmung bei Erreichen des 14. Lebensjahres abzuhalten. Ich gehörte zu den Ersten, die bereits mit neun Jahren an dem kirchlichen Ritual teilnehmen durften. Es war für mich eher anstrengend als erhebend; eine Menge Verwandte hatten sich eingefunden, denen ich im blauen Kadettenanzug mit langer Hose präsentiert wurde; zum Nachtisch gab es köstliches Eis, von dem ich zu meinem großen Bedauern aber nichts abbekam, weil nach dem Hauptgang die Zeit so fortgeschritten war, dass ich mich ohne Aufschub zur festlichen Nachmittagsvesper in die Pfarrkirche begeben musste.
Meine Großmutter schenkte mir bei dieser Gelegenheit eine für ein Kind total unangebrachte vergoldete Sprungdeckeluhr. Sie war eine fromme und fröhliche Frau, obwohl sie bereits als Vierzigjährige Witwe geworden war und mit einer bescheidenen Rente fünf Kinder durchbringen musste. Ihr Gedächtnis war phänomenal, mit 70 Jahren noch konnte sie eine halbe Stunde lang ohne Pause frei aus den Liebesbriefen ihres Mannes zitieren. Einige ihrer Aussprüche flechte ich gelegentlich heute noch in meinen Text ein, wenn ich eine offizielle Ansprache halten muss.
Ihre liebste Lebensregel teilte sie gerne in Aachener Platt mit: »Wä gett, wat hä hatt, es wäet, datt hä leeft, en mot ästimeert wäede! (Wer gibt, was er hat, ist wert, dass er lebt, und muss respektiert werden!)«. Eine andere trug sie nur auf Hochdeutsch vor: »Eine Mark ausgeben oder sparen, macht den Unterschied von zwei Mark!« Ich verwende sie gerne, wenn ich meine Worte an Politiker und Ökonomen richte.
Meine kirchlichen Verpflichtungen nahmen schon in meiner frühesten Jugend einen beträchtlichen Raum ein. Mein Vater war in seiner Knabenzeit Messdiener gewesen und machte es sich zur Aufgabe, mir das Messlatein beizubringen, bevor ich noch lesen und schreiben konnte. Als das Schwierigste galt dabei das Opfergebet »Suscipiat«, das ich aber bereits als Fünfjähriger mit den übrigen Obligatorien brav – und ohne ein Wort zu verstehen – aufsagen konnte. Damit weckte ich den Ehrgeiz meiner Mutter, die mich prompt als Novizen für den Messdienst im Asteneter Ursulinenkloster anmeldete. Dort gab es ein ausgezeichnetes Internat für angehende Damen mit Nonnen als Lehrerinnen, aber außer einem Hausmeister und Knechten der Klostermeierei keine Männer. Die Gottesdienste hielt ein pensionierter Pfarrer ab, der im Altersstift des Klosters wohnte. Die Einwohner von Astenet, eines kleineren Teilorts der Gemeinde Walhorn, hatten durch eine namhafte Spende zum Bau der Klosterkapelle beigetragen und sich damit das Recht zur Teilnahme an allen Gottesdiensten erworben. Damit ersparten sie sich zwei Kilometer Fußweg zur Pfarrkirche in Walhorn, der dortige Pfarrer sah die lokale Abspaltung allerdings nicht besonders gerne.
Durch die Initiative meiner Mutter avancierte ich also bereits im Vorschulalter zum Messdiener, es gab jedoch zu dieser Zeit zwei oder drei Mit-Ministranten, die einige Jahre älter waren. Ich musste fürs Erste nur einige Male in der Woche pünktlich meinen Dienst antreten; mit der Zeit wurde ich aber mehr und mehr in die Pflicht genommen. Besonders als ich in die Schule kam – ich war noch nicht ganz sechs – wurde mein Einsatz Zeit raubend. Zum Messdienst in der Klosterkapelle hatte ich einen Weg von fast einem Kilometer, die Messe dauerte eine halbe Stunde, begann um halb sieben und war um sieben zu Ende. Die Schulstunden dauerten von acht bis zwölf und von zwei bis vier, der Schulweg musste zweimal am Tag, vormittags und nachmittags, mit je fast zwei Kilometern, also täglich acht Kilometer, absolviert werden. Das alles galt auch für die kalte Jahreszeit mit den Regenmonaten der Voreifel, Schnee und Eis.
Читать дальше