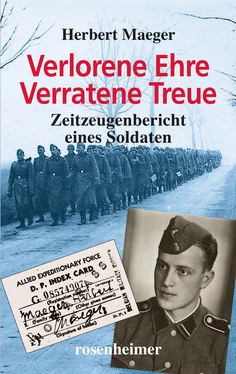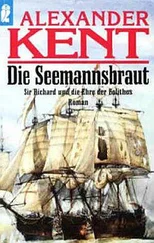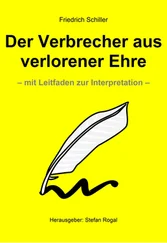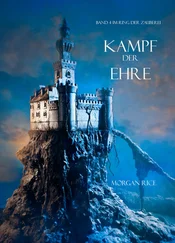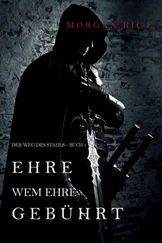Ein Kamerad in meiner Gruppe, er war ein Bauer aus Niederösterreich namens Pold, musste regelmäßig auf einen Spind in unserer fast vier Meter hohen Stube der ehemaligen preußischen Kadettenanstalt klettern, sich dort niederhocken und immer wieder den schwachsinnigen Satz rufen: »Ich, Nepomuk von Schlips, sitze auf dem Baum und wackle mit den Ohren, weil ich ein krummgeficktes Eichhörnchen bin. In Ewigkeit, Amen.« Pold fiel wenige Wochen später in Russland.
Die Art von Disziplin, die so erzeugt wurde, zerstörte letzten Endes die individuelle Moral und damit die soldatische Ethik des deutschen Soldaten, von der beispielsweise in dem von mir zuvor mit Begeisterung gelesenen Buch »In Stahlgewittern« von Ernst Jünger so eindringlich und pathetisch die Rede war. Sterben lernten sie, die Soldaten der Leibstandarte, aber für den Kampf wurden sie vorbereitet mit einer Mentalität, die im Effekt nichts anderes entwickelte als den selbstmörderischen Mechanismus von Robotern. Nach meiner Beobachtung und Erfahrung war hierfür vor allem das niedrige Persönlichkeits-Niveau des Unteroffizierskorps maßgebend.
Persönlich hatte ich allerdings das Glück, im Fronteinsatz fast immer Offiziere zu Vorgesetzten zu haben, die meine individuelle Selbstbehauptung respektierten und mir Aufgaben zuwiesen, die mir gerecht wurden. Das muss als um so bemerkenswerter angesehen werden, als ich mich beharrlich weigerte, SS-Offizier zu werden. Hierzu hätte ich mich über meine Kriegsfreiwilligkeit hinaus für zwölf Jahre bei der Leibstandarte, die nur Berufsoffiziere kannte, verpflichten müssen. Mir wurde schon bald klar, dass meine Zukunftsvorstellungen sich beim Kommiss und speziell bei dieser Truppe nicht verwirklichen ließen, und dass es darauf ankam, diese Epoche meines Lebens so ersprießlich wie möglich zu überstehen.
Zunächst aber ging es darum, die Rekrutenzeit einigermaßen passabel hinter mich zu bringen, die sich wegen des besonderen Interesses, das einige schikanierfreudige Uschas an mir zeigten, fast bis Ende 1942 dauern sollte. Danach erfreute ich mich praktisch über die restliche Zeit meiner LAH-Zugehörigkeit einer gewissen Sonderstellung; befördert wurde ich – wenn ich die Episode meiner zwei Monate an der SS-Junkerschule Prag außer Betracht lasse – über den Rottenführer (Obergefreiten) hinaus nicht, aber meine Kompaniechefs gaben mir nach meinem ersten Kommissjahr fast ständig sozusagen eine »Z.b.V.-(Zur besonderen Verwendung)-Funktion«. Nie habe ich einen Befehl ausführen müssen, der gegen mein Gewissen oder meine Prinzipien verstoßen hätte. Dabei habe ich aber vermutlich auch einfach Glück gehabt.
Meine Motivation war klar: Nach Herkunft und Erziehung war es mir unmöglich, mit meinen Befehlen Menschen in den sicheren Tod zu schicken, was ein Offizier unvermeidlich tun muss. Ich habe jedoch an der Front in meinem Bereich stets meine Pflicht getan, auch freiwillig riskante Kommandos übernommen, wenn es zum Beispiel galt, Verwundete zu bergen. Irgendwie entwickelte ich mit der Zeit ein spezielles Talent zur Lösung von Problemen, über die in der HDV nichts stand; ich fand später als Fahrer des Kompaniechefs und damit des Führungsfahrzeugs einer Kolonne auch im russischen Schneesturm mit beachtlicher Genauigkeit das Marschziel. Ähnlich zuverlässig entwickelte ich ein Gespür dafür, wenn irgendwo etwas Essbares oder Trinkbares über die frugale Truppenverpflegung hinaus ausfindig gemacht werden konnte. Ich wurde eine Art Spezialist im »Organisieren« – ein Kommissbegriff für jedwede Art der Beschaffung von Dingen, die man gemeinhin entbehren musste. Aber davon wird noch in anderen Zusammenhängen die Rede sein.
In Berlin war deutlich zu spüren, wie sehr die Substanz der alten LAH in den Feldzügen in Polen, in Frankreich, auf dem Balkan und in den ersten vier Monaten in Russland dezimiert worden war. Gerüchten zufolge, die uns erreichten, betrug die durchschnittliche Kampfstärke der Fronteinheiten nur noch etwa 20 Prozent. Es wurde deutlich, dass auch für die notwendigen Reserven die Führung nicht die erforderliche Vorsorge getroffen hatte. Offenbar war man in das russische Abenteuer marschiert mit der Wahnvorstellung, es handele sich um einen militärischen Spaziergang, um einen »Blitzkrieg« mehr in der Kette der Erfolge schneller Feldzüge. Die Art und Weise, wie man nun den auf die Schnelle ausgebildeten Nachschub vorbereitete, war ein Beweis dafür, dass man aus den Erfahrungen kaum die nahe liegenden Schlussfolgerungen gezogen hatte. Man tat so, als ob nichts unerschöpflicher und billiger sei als »Menschenmaterial«, und das angesichts einer wachsenden Zahl von Feinden in aller Welt. »Meine Ehre heißt Treue« stand auf unseren Koppelschlössern: ein Spruch, dem die Führung ihrerseits in ihrem ethischen Verhalten nicht entsprach.
Meine Einstellung zur Waffen-SS mag widersprüchlich erscheinen und sie ist es schon deshalb, weil die Waffen-SS eine Truppe voller Widersprüche war: Weder war sie eindeutig heroisch mit fleckenlosem Schild, noch war sie grundsätzlich gekennzeichnet von der erbarmungslosen Härte gegen den kriegsgefangenen Gegner oder von der Brutalität gegen die Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten, die man ihr immer wieder nachsagte.
Soldat sein ist ein sehr persönliches Erlebnis. Von einer Uniform wird man geprägt und im besten Falle versucht man, die positiven Ideale zu verwirklichen, die gewöhnlich damit verbunden sind. Außerdem hat man es in einer militärischen Einheit nicht nur mit dem Gruppenzwang zu tun, sondern mit vielen Menschen – Individuen, die immer wieder in einer ganz persönlichen Verantwortung ihr Verhalten entscheiden müssen.
Der nur geringe moralische Spielraum, den man als Soldat in seinem Handeln hat, wird bestimmt von Veranlagung und Erziehung, aber auch von der Selbsterfahrung im Angesicht des Todes. Hat man zu einer eigenen neuen Haltung gefunden, so erwächst daraus eine Verpflichtung anderen gegenüber, die man Kameradschaft oder – gegenüber dem wehrlosen Gegner – Ritterlichkeit nennt, und der man sich mit Anstand nicht entziehen kann.
Das also waren die Situation und die Gemeinschaft, in die ich von einem Tag auf den anderen hineinversetzt wurde. Wie war es eigentlich dazu gekommen? Die Antwort auf diese Frage ist nicht in drei Sätzen abgetan. Nach der schnoddrigen Definition der damaligen Zeit war ich ein »Beutegermane« und als solcher fühlte ich mich auch. Wer zwei Vaterländer hat, hat zwei halbe, oder er muss sich ohne Vorbehalte für eines mit allen Konsequenzen entscheiden. Das hatte ich zugunsten Deutschlands zwar getan, aber der Schritt aus einem streng katholischen Elternhaus und einem klerikalen Gymnasium in die Waffen-SS war eine andere Sache und wurde nicht ohne innere Auseinandersetzungen vollzogen. Vorangegangen war eine Entwicklung, die von vielen Erfahrungen und Erlebnissen eines Kindes und Jugendlichen geprägt war.
*) Heeres-Dienst-Vorschrift.
Zwischen zwei Vaterländern
Mein erster einschneidender Konflikt mit mir selbst entstand, als ich mit knapp sechs Jahren in die belgische Volksschule kam und lesen lernte. In unserem ersten deutschsprachigen Lesebuch stand auf der ersten Seite als Zitat die Frage von Ernst Moritz Arndt: »Was ist des Menschen Vaterland?« und auch seine Antwort: »… dort, wo ihm Gottes Sonne zuerst schien und seine Sterne zuerst leuchteten …«. Darüber machte ich mir Gedanken. War mein Vaterland, wo mir die Sonne zuerst schien, demnach Belgien, das Land, das laut Cäsar und ebenfalls laut Lesebuch bewohnt war »von den Tapfersten aller Gallier«? Oder war mein Vaterland das Land, in dem meine Eltern geboren waren, die deutsch sprachen wie fast alle in den »belgischen Ostkantonen«, das wallonisch-sprachige Malmedy und einige Dörfer seiner Umgebung ausgenommen? War mein Vater, der stolz darauf war, im preußischen 4. Garderegiment in Berlin gedient zu haben, 1915 als junger Reservist bei Arras in Nordfrankreich schwer verwundet wurde und nur knapp überlebte, eigentlich ein Deutscher? Und wieso war er nun ein Belgier und kein Deutscher mehr?
Читать дальше