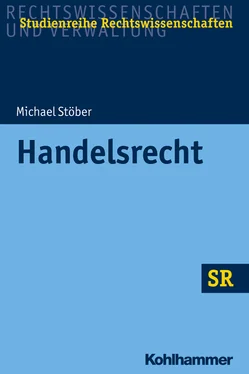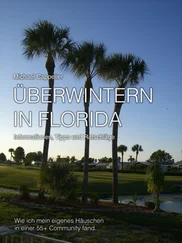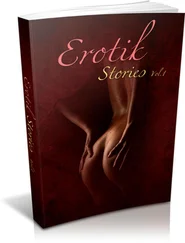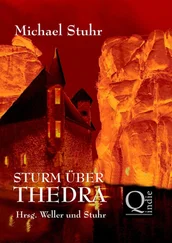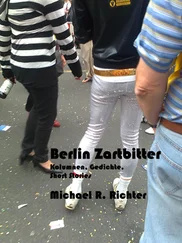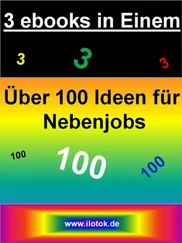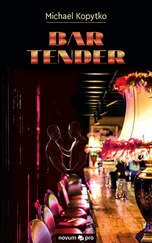30 Indizien füreine Selbstständigkeit sind beispielsweise
– das Fehlen eines Arbeitsplans und fester Arbeitszeiten; 35
– die Unabhängigkeit von Weisungen anderer; 36
– der Umstand, dass Kosten und Risiken der Tätigkeit selbst getragen werden; 37
– die Beschäftigung eigenen Personals; 38
– das Vorhandensein eigener oder gemieteter Geschäftsräume; 39
– das Fehlen einer festen Vergütung; 40
– die Nichtabführung von Sozialabgaben. 41
5.Planmäßig auf gewisse Dauer ausgeübte Tätigkeit
31Außer Streit steht auch, dass nur eine planmäßig auf gewisse Dauer ausgeübte Tätigkeitvom Gewerbebegriff erfasst wird. Die Tätigkeit muss also auf eine Vielzahl von Geschäften gerichtet sein und darf nicht bloß gelegentlichausgeübt werden. 42Kein Gewerbe ist daher die hin und wieder erfolgende Veräußerung bislang privat genutzter Sachen, etwa aussortierter Kleidung auf dem Flohmarkt oder eines gebrauchten Kraftfahrzeugs. 43
6.Erfordernis einer Gewinnerzielungsabsicht?
32Streitig ist wiederum, ob die Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht ausgeübtwerden muss, um als Gewerbe angesehen werden zu können. Die Rechtsprechungfordert für die Einordnung als Gewerbe die Absicht, einen Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben zu erwirtschaften; ob tatsächlich ein Gewinn erzielt wird, ist dagegen auch nach der Rechtsprechung unerheblich. 44Auch das Einkommensteuerrecht verlangt in § 15 Abs. 2 Satz 1, 3 EStG für die Einordnung als Gewerbebetrieb, dass die Absicht, einen Gewinn zu erzielen, zumindest einen Nebenzweck der Betätigung darstellt. Die Gegenansichthält eine Gewinnerzielungsabsicht für entbehrlich; ausreichend sei eine anbietende, entgeltliche Tätigkeit am Markt. 45Ebenso verzichtet das Umsatzsteuerrecht für die Einordnung als Unternehmer in § 2 Abs. 1 Satz 3 UStG ausdrücklich auf eine Gewinnerzielungsabsicht.
33Indes wird man es schon semantisch als dem Begriff des Gewerbes immanent ansehen müssen, dass es sich um eine Erwerbstätigkeit und mithin um eine Tätigkeit handelt, die auf die Erzielung eines Gewinns gerichtet ist. Mit der Rechtsprechung ist die Gewinnerzielungsabsicht daher als notwendiges Merkmaleiner gewerblichen Tätigkeit anzusehen. Weil die Rechtsprechung eine Gewinnerzielungsabsicht aber bei privaten Unternehmenvermutet, 46kommen die beiden widerstreitenden Ansichten hinsichtlich der Einordnung als Gewerbe bei privaten Unternehmen in der Regel nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen. Eine abweichende Beurteilung kann sich jedoch bei Unternehmen der öffentlichen Handergeben. Weil bei diesen die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben im Vordergrund steht, wird die Gewinnerzielungsabsicht hier nach der Rechtsprechung nicht vermutet, sondern muss im Einzelfall nachgewiesen werden. 47Ebenfalls unterschiedlich werden karitative Unternehmenbeurteilt, die lediglich eine Deckung ihrer Kosten und keinen Überschuss anstreben. Verlangt man mit der hier vertretenen Auffassung eine Gewinnerzielungsabsicht, so sind diese Unternehmen nicht als gewerblich einzuordnen. 48Die abweichende Ansicht kommt zu einem entgegengesetzten Ergebnis und bejaht auch bei karitativen Unternehmen ein Gewerbe, sofern diese eine anbietende, entgeltliche Tätigkeit am Markt ausüben. 49
7.Vom Gewerbebegriff ausgenommene Tätigkeiten
34Aus historischen Gründen fallen freie Berufe, künstlerische oder wissenschaftliche Betätigungen und auch die Urproduktion(d. h. Land- bzw. Forstwirtschaft, s. § 3 Abs. 1 HGB) aus dem Gewerbebegriff heraus. 50Dies gilt nicht nur für das Handelsrecht, sondern gem. § 15 Abs. 2 Satz 1 EStG auch für das Einkommensteuerrecht. Da das Gewerbesteuerrecht in § 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG an den einkommensteuerrechtlichen Begriff des Gewerbebetriebs anknüpft und Freiberufler, Künstler, Wissenschaftler sowie Land- und Forstwirte nach diesem Begriff keine gewerbliche Tätigkeit ausüben, unterliegen diese im Unterschied zu Gewerbetreibenden auch nicht der Gewerbesteuer.
35Weil Freiberufler, Künstler, Wissenschaftler sowie Land- und Forstwirte auch handelsrechtlich kein Gewerbe betreiben und somit – vorbehaltlich des § 3 HGB (dazu Rn. 48 ff.) – keine Kaufleute sind, ist der Kaufmannsbegriff des HGB enger als der Unternehmerbegriff des § 14 BGB,der auch Personen umfasst, die nichtgewerblich selbstständig beruflich tätig sind 51(s. bereits Rn. 12). Jeder Kaufmann ist also Unternehmer; umgekehrt gilt dies aber nicht.
36Gewerbliche Unternehmen zeichnen sich typischerweise dadurch aus, dass der Inhaber Leistungen erbringt, die auf dem Einsatz von Personal- und Sachmitteln beruhen (z. B.: Mit Hilfe angestellter Arbeitskräfte werden in einer Fabrik Waren hergestellt und sodann in einem Ladenlokal durch weitere angestellte Arbeitskräfte verkauft). Demgegenüber sind freie Berufedadurch gekennzeichnet, dass sie in der Regel auf individuelle, höchstpersönliche, eher „geistige“ Leistungen gerichtet sind. 52Freiberufler sind beispielsweise
– Ärzte und Zahnärzte;
– Rechtsanwälte und Notare;
– Architekten;
– Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. 53
Apotheker werden hingegen nicht als Freiberufler angesehen, weil die höchstpersönliche Leistung hier hinter dem Einsatz von Personal- und Sachmitteln zurücktritt. 54
37 KünstlerischeTätigkeiten sind solche, bei denen eine schöpferische Leistung von gewissem künstlerischen Wert im Mittelpunkt steht. Dies trifft in der Regel auf die Tätigkeit von Malern, Bildhauern, Sängern, Schauspielern, Komponisten oder Schriftstellern zu. 55Als wissenschaftlicheTätigkeit ist nur die originäre wissenschaftliche Schöpfung und Ausarbeitung in Gestalt von eigenen Erfindungen oder Forschungsergebnissen (etwa in Form von Gutachten oder Vorträgen) anzusehen. 56Für Land- und Forstwirtschaftist die organische Nutzung von Grund und Bodenzur Gewinnung von Nutzpflanzen, Nutztieren und deren Erzeugnissen kennzeichnend (dazu noch Rn. 48).
38Kaufmann ist nach § 1 Abs. 1, Abs. 2 Halbs. 1 HGB derjenige, der das Gewerbe betreibt.Dies ist das Rechtssubjekt, in dessen Namen das Gewerbe geführt wird, 57bzw. dasjenige Rechtssubjekt, das aus den im Gewerbebetrieb geschlossenen Geschäften berechtigt und verpflichtet wird. 58Bei einer Kapitalgesellschaft(GmbH, AG, SE) wird der Gewerbebetrieb allein im Namen der Gesellschaft geführt, und nur diese wird aus den dabei geschlossenen Geschäften berechtigt und verpflichtet. Die Geschäftsführer bzw. der Vorstand oder gar die Gesellschafter bzw. Aktionäre einer GmbH bzw. AG oder SE sind dementsprechend keine Kaufleute. 59
39Dagegen ordnete die ältere Rechtsprechung die geschäftsführungs- und vertretungsberechtigten persönlich haftenden Gesellschafter einer OHG oder KGals Kaufleute ein, weil die OHG und die KG im Unterschied zur GmbH und zur AG keine eigenständigen Rechtssubjekte seien. 60Indes beruht diese Rechtsprechung noch auf der inzwischen überholten Vorstellung, dass bei Personengesellschaften nur den Gesellschaftern, nicht aber der Gesellschaft als solcher Rechtsfähigkeit zukomme. Spätestens mit der Anerkennung der Rechts- und Parteifähigkeit auch der GbR durch das „Weißes Ross“-Urteil des BGH vom 29.1.2001 61wird man diese Sichtweise als obsolet ansehen müssen. Auch bei der OHG und der KG wird das Gewerbe daher nur von der Gesellschaft als solcher und nicht von den Gesellschaftern betrieben, so dass Letztere keine Kaufleute sind. 62
Читать дальше