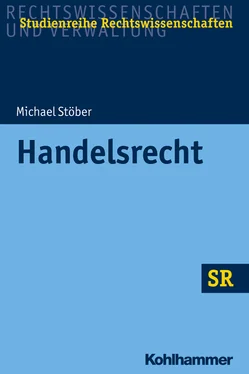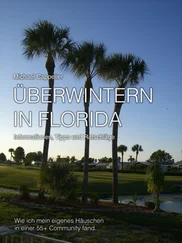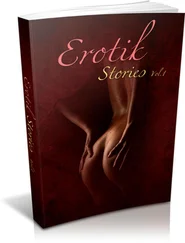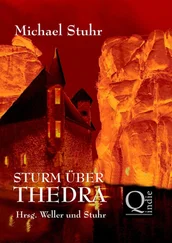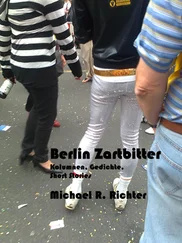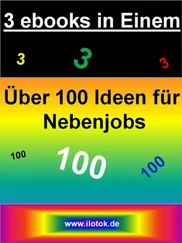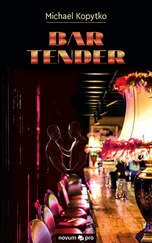Wie im Fall 1 (dazu Rn. 23) kann M nach den allgemeinen Vorschriften des BGB mangels vorheriger Mahnung erst ab dem 3. Mai Verzugszinsenin Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 1.500 € verlangen (s. § 288 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 i. V. m. § 286 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 BGB). Ein Anspruch auf Zinsen ab dem 2. April – dem Tag der Fälligkeit der Vergütungsforderung des M – kann sich aber wiederum aus § 353 Satz 1 HGBergeben. Dies setzt voraus, dass sowohl M als auch die UG Kaufmann ist und der Werkvertrag jeweils zum Betrieb des Handelsgewerbes gehört (s. § 343 Abs. 1 HGB).
Wie bereits zu Fall 1 festgestellt wurde (s. Rn. 47), ist M Kaufmann nach § 2 Satz 1 HGB. Es stellt sich die Frage, ob auch die UG Kaufmann ist. Wie zu Fall 1 dargelegt wurde, erfordert das Obst- und Gemüseunternehmen keinen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb; es handelt sich also um ein Kleingewerbe,das nach § 1 Abs. 2 Halbs. 2 HGB an sich kein Handelsgewerbe darstellt. Die Kaufmannseigenschaft der UG könnte sich jedoch aus § 6 Abs. 2 HGB ergeben.
55Nach § 6 Abs. 2 HGBsind juristische Personen(„Vereine“), denen das Gesetz ohne Rücksicht auf den Gegenstand ihres Unternehmens die Kaufmannseigenschaft zuschreibt, auch dann als Kaufleute anzusehen, wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 HGB nicht vorliegen (sog. Formkaufleute). Formkaufleutesind folgende juristische Personen:
– die GmbH(s. § 13 Abs. 3 GmbHG: „Die Gesellschaft gilt als Handelsgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuchs“);
– die AG(s. § 3 Abs. 1 AktG: „Die Aktiengesellschaft gilt als Handelsgesellschaft, auch wenn der Gegenstand des Unternehmens nicht im Betrieb eines Handelsgewerbes besteht“);
– die KGaA (s. § 278 Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 1 AktG);
– die eingetragene Genossenschaft(eG, s. § 17 Abs. 2 GenG: „Genossenschaften gelten als Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuchs“);
– die mit Wirkung vom 8.10.2004 durch die SE-VO 91EU-weit eingeführte Europäische Aktiengesellschaft(Societas Europaea – SE; s. Art. 9 Abs. 1 Buchst. c Ziff. iii SE-VO i. V. m. § 3 Abs. 1 AktG). 92
56Die genannten juristischen Personen sind allein kraft ihrer RechtsformKaufleute; ob sie ein Handelsgewerbe i. S. d. § 1 Abs. 2 HGB oder überhaupt ein gewerbliches Unternehmen betreiben, ist ohne Belang. Eine GmbH, AG, KGaA, eG oder SE ist also selbst dann Formkaufmann, wenn sie ein nichtgewerbliches, z. B. ein freiberufliches Unternehmen betreibt. Mit der Regelung des § 6 Abs. 2 HGB trägt der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass die von der Regelung erfassten Rechtsformen primär für gewerbliche Unternehmen gedacht sind; aus Gründen der Vereinfachungder Rechtsanwendung legt § 6 Abs. 2 HGB Unternehmensträgern in diesen Rechtsformen daher typisierend stets die Kaufmannseigenschaft bei. Steuerrechtliche Parallelregelungen finden sich in § 8 Abs. 2 KStG, § 2 Abs. 2 Satz 1 GewStG. Danach sind u. a. bei im Inland ansässigen Kapitalgesellschaften und eingetragenen Genossenschaften alle Einkünfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln und die Tätigkeit stets und in vollem Umfang als Gewerbebetrieb anzusehen, ohne dass es darauf ankommt, ob die betreffende Körperschaft tatsächlich einer gewerblichen Betätigung i. S. d. § 15 Abs. 2 EStG nachgeht.
Im Fall 2wird der Obst- und Gemüseladen zwar nicht von einer „regulären“ GmbH, sondern von einer UG betrieben. Bei der UG handelt es sich jedoch lediglich um eine besondere Art einer GmbH, deren Stammkapital nicht den Mindestbetrag von 25.000 € erreicht. Vorbehaltlich des § 5a GmbHG gelten die Vorschriften für die GmbH daher auch für die UG. Auch § 13 Abs. 3 GmbHG ist mithin auf die UG anwendbar; die UGist also ebenfalls Formkaufmanngem. § 6 Abs. 2 HGB i. V. m. § 13 Abs. 3 GmbHG. Darauf, dass der von der UG betriebene Obst- und Gemüseladen ein Kleingewerbe und damit nach § 1 Abs. 2 Halbs. 2 HGB kein Handelsgewerbe ist, kommt es für die Eigenschaft als Formkaufmann nicht an.
Weil der Werkvertrag über die Malerarbeiten im Ladenlokal auch zum Betrieb des von der UG geführten Obst- und Gemüsehandels gehört, stellt der Werkvertrag auch für die UG ein Handelsgeschäft dar (§ 343 Abs. 1 HGB). Es handelt sich folglich um ein beiderseitiges Handelsgeschäft.M kann daher von der UG gem. §§ 353 Satz 1, 352 Abs. 2 HGB ab dem 2. April Fälligkeitszinsen aus 1.500 € in Höhe von 5 % p. a. verlangen.
VI.Kaufmann kraft Eintragung im Handelsregister
→ Lsg. Fall 3 Rn. 425
Fall 3:
Leo Löwe (L) hat früher unter der im Handelsregister eingetragenen Firma „Leo Löwe e. K.“ ein großes Bestattungsunternehmen betrieben. Als gelernter Steinmetz hat L etliche Grabskulpturen nach Kundenwünschen selbst angefertigt. Im Laufe der Zeit hat L immer größeren Gefallen an der Bildhauerei gefunden und deshalb den Betrieb des Bestattungsunternehmens aufgegeben. Eine Löschung der Firma im Handelsregister ist nicht erfolgt. Seitdem widmet sich L in den Räumlichkeiten des früheren Bestattungsunternehmens ganz der Kunstbildhauerei und fertigt vor allem Marmorskulpturen an.
L will seine Skulpturen in einer Vernissage ausstellen, die von der Galeristin Gitta Ginster (G) durchgeführt wird. Die Ausstellungshalle hat G eigens für die Vernissage von Volker Vogel (V) gemietet. Weil G aber den vereinbarten Mietvorschuss von 5.000 € nicht aufbringen kann, verweigert V die Überlassung der Halle. Um die Vernissage zu retten, teilt L dem V auf Bitten der G per E-Mail mit, dass er sich für die von G geschuldete Miete von 5.000 € verbürge. Um V zu beeindrucken, gibt L in der E-Mail an, dass er Inhaber eines großen Bestattungsinstituts mit 20 Mitarbeitern und Jahresumsätzen in siebenstelliger Höhe sei und auf der Vernissage kunstvolle Grabskulpturen zwecks Kundenakquise ausstellen wolle. Weil V das Bestattungsunternehmen noch aus früheren Zeiten kennt und nichts von dessen Einstellung weiß, stellt er daraufhin die Halle doch zur Verfügung. Nach Durchführung der Vernissage gelingt es der G jedoch weiterhin nicht, die Miete aufzubringen.
V verlangt nunmehr von L die Zahlung von 5.000 €. L verweigert die Zahlung mit dem Hinweis, dass V „nichts Schriftliches“ in der Hand habe. Kann V von L die Zahlung von 5.000 € verlangen?
1.Fiktivkaufmann (§ 5 HGB)
Im Fall 3hat L die Bürgschaftserklärung gegenüber V nur per E-Mail und mithin nicht in der nach § 766 Satz 1 BGB grundsätzlich einzuhaltenden Schriftform des § 126 Abs. 1 BGB abgegeben. Möglicherweise war die Schriftform jedoch gem. § 350 HGBentbehrlich. Dies setzt voraus, dass die Bürgschaft für den Bürgen L ein Handelsgeschäft i. S. d. § 343 Abs. 1 HGB ist, was wiederum voraussetzt, dass L Kaufmannist.
57Nach § 2 Satz 1 HGBgilt ein Unternehmen, das nicht die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 HGB erfüllt, gleichwohl als Handelsgewerbe und sein Inhaber damit als Kaufmann, wenn die Firma des Unternehmens in das Handelsregister eingetragenist ( Kann-Kaufmann,s. dazu Rn. 46 ff.). Voraussetzung für die Anwendung des § 2 HGB ist aber stets das Vorliegen eines gewerblichenUnternehmens (s. § 2 Satz 1 HGB); der Inhaber eines nichtgewerblichen, etwa eines freiberuflichen oder eines künstlerischen Unternehmens, kann also auch nach § 2 Satz 1 HGB nicht Kaufmann sein (s. Rn. 47).
58Auch § 5 HGBregelt den Fall, dass für ein Unternehmen eine Firma im Handelsregister eingetragen ist, und bestimmt, dass demjenigen, der sich auf die Handelsregistereintragung beruft, nicht entgegengehalten werden kann, dass das betreffende Unternehmen kein Handelsgewerbe sei. Auch nach § 5 HGB gilt derjenige, der im Handelsregister eingetragen ist, also als Kaufmann (sog. Fiktivkaufmann). Auf die Handelsregistereintragung kann sich im Rahmen des § 5 HGB nicht nur ein Dritter, sondern auch der Eingetragene selbst berufen, so dass die Vorschrift sowohl zugunsten als auch zulasten des Eingetragenen wirkt. 93Auf die Gut- oder Bösgläubigkeit des Dritten, der sich auf die Handelsregistereintragung beruft, kommt es bei § 5 HGB – anders als bei § 15 Abs. 1 HGB (dazu u. Rn. 63 f.) sowie nach den Regeln über den Scheinkaufmann (dazu u. Rn. 65 ff.) – nicht an. 94
Читать дальше