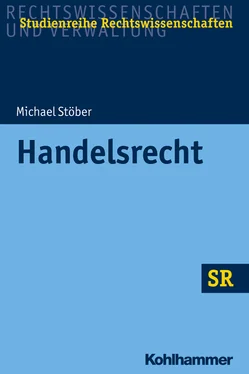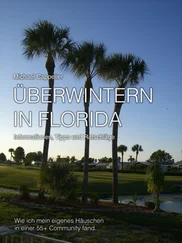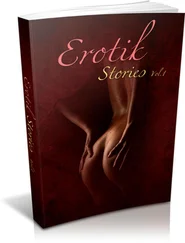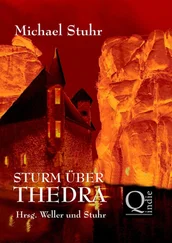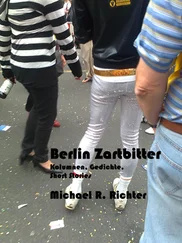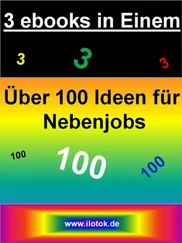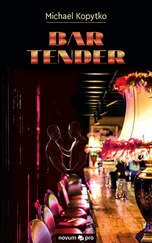13Im Schrifttumwird allerdings die Auffassung vertreten, zumindest bestimmte Vorschriften des HGB seien auch auf nichtkaufmännische Unternehmerentsprechend anzuwenden. Diese Position nimmt namentlich K. Schmidt ein, der das Handelsrecht als Außenprivatrecht des Unternehmens begreift und das Handelsrecht zumindest de lege ferenda auf alle – d. h. auch auf nichtkaufmännische – Unternehmer anwenden will. 19Diesem Konzept folgt nunmehr der österreichische Gesetzgeber. Mit Wirkung vom 1.1.2007 wurde das österreichische HGB umfassend geändert und in „Unternehmensgesetzbuch“ (UGB) umbenannt 20(s. dazu bereits Rn. 2). In Österreich gelten die handelsrechtlichen Sondervorschriften seitdem weitgehend für alle Unternehmer, ohne dass es auf den Betrieb eines Gewerbes ankommt. Der deutsche Gesetzgeber hat dagegen auch im Rahmen der Handelsrechtsreform von 1998 21an der Beschränkung des Anwendungsbereichs des HGB auf Kaufleute festgehalten. De lege lata ist daher grundsätzlich für eine (analoge) Anwendung handelsrechtlicher Vorschriften auf nichtkaufmännische Unternehmer kein Raum. 22
IV.Zielsetzung der handelsrechtlichen Sondervorschriften
14Die Sondervorschriften des HGB tragen den besonderen BedürfnissenRechnung, die im kaufmännischen Geschäftsverkehrbestehen. Im Vergleich zum Rechtsverkehr unter Privatpersonen zeichnet sich der Geschäftsverkehr unter Kaufleuten dadurch aus, dass routinemäßig eine Vielzahl von Rechtsgeschäften getätigt wird. Es besteht daher im kaufmännischen Geschäftsverkehr ein besonderes Bedürfnis nach
– Schnelligkeit,
– Einfachheit,
– Rechtssicherheit und
– Klarheit
beim Abschluss und bei der Durchführung von Rechtsgeschäften.
15Zudem haben die im kaufmännischen Geschäftsverkehr Tätigen eine größere Geschäftsgewandtheit und -erfahrung.Im Vergleich mit den allgemeinen Regeln des BGB sieht das HGB daher für Kaufleute
– strengere Sorgfaltspflichten (s. § 347 Abs. 1 HGB; dazu Rn. 260) und Obliegenheiten (z. B. kaufmännische Rügeobliegenheit nach § 377 HGB; dazu Rn. 336 ff.),
– einen gesteigerten Verkehrs- und Vertrauensschutz und eine strengere Rechtsscheinhaftung (z. B. Publizität des Handelsregisters nach § 15 HGB; dazu Rn. 211 ff.) und
– ein niedrigeres Schutzniveau (z. B. Entbehrlichkeit der Schriftform für Bürgschaft nach § 350 HGB; dazu Rn. 277 ff.) vor.
16Jeder Kaufmann hat eine Firma. Die Firma ist nur der Name des Kaufmanns (s. § 17 HGB).Entgegen dem alltäglichen Sprachgebrauch ist der Begriff „Firma“ nicht gleichbedeutend mit „Unternehmen“ oder „Betrieb“. Vielmehr ist die Firma allein der Name, unter dem ein Kaufmann im Rechtsverkehr auftritt und auch klagen und verklagt werden kann (eingehend zum Firmenrecht des HGB s. Rn. 75 ff.).
17Aufgrund des im kaufmännischen Verkehr bestehenden erhöhten Bedürfnisses an Klarheit und Rechtssicherheit muss jede Firma erkennen lassen, welche Rechtsform der Kaufmann hat. Auf diese Weise soll der Rechtsverkehr insbesondere ersehen können, ob für die im kaufmännischen Unternehmen begründeten Verbindlichkeiten eine natürliche Person persönlich und uneingeschränkt haftet (so bei Einzelkaufleuten und Personenhandelsgesellschaften; s. Rn. 5) oder ob für die Geschäftsverbindlichkeiten nur ein Gesellschaftsvermögen haftet (so bei den Kapitalgesellschaften, d. h. GmbH, AG, SE). Auch die KGaA ist eine Kapitalgesellschaft; bei ihr besteht aber die Besonderheit, dass sie – neben den Kommanditaktionären, die keine persönliche Haftung trifft – mindestens einen persönlich haftenden Gesellschafter haben muss, der den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (§ 278 Abs. 1 AktG). Damit die Rechtsform des Unternehmens und damit die Haftungsverhältnisse für den Rechtsverkehr erkennbar sind, muss jede Firma einen Rechtsformzusatzin Gestalt eines zumindest abgekürzten Hinweises auf die Rechtsform des Firmeninhabers haben:
– e. K.bei einem Einzelkaufmann, s. § 19 Abs. 1 Nr. 1 HGB;
– OHG, KGbei Personenhandelsgesellschaften, s. § 19 Abs. 1 Nr. 2, 3 HGB;
– GmbH(s. § 4 Satz 1 GmbHG), AG(§ 4 AktG), KGaA(s. § 279 Abs. 1 AktG), SE(Art. 11 Abs. 1 SE-VO) bei Kapitalgesellschaften.
18Dem Bedürfnis nach Einfachheit, Klarheit und Rechtssicherheit im kaufmännischen Verkehr dient auch das Handelsregister, das in den §§ 8–16 HGB geregelt ist (näher dazu noch Rn. 211 ff.). Das Handelsregister ist ein öffentliches Verzeichnis bestimmter, für den Handelsverkehr wichtiger Rechtstatsachen.Das Handelsregister wird durch die Amtsgerichte geführt (§ 8 Abs. 1 HGB, § 23a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 3 GVG, § 374 Nr. 1 FamFG).
19In das Handelsregister werden zum einen Rechtstatsachen eingetragen, deren Eintragung das Gesetz zwingend vorschreibt (eintragungspflichtige Tatsachen),etwa die Firma des Kaufmanns (§ 29 HGB). Zum anderen werden Tatsachen eingetragen, deren Eintragung das Gesetz zulässt (eintragungsfähige Tatsachen),z. B. im Falle der Unternehmens- und Firmenfortführung die Vereinbarung zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber des Unternehmens, dass Letzterer für die Geschäftsverbindlichkeiten des Veräußerers nicht haftet (§ 25 Abs. 2 HGB; dazu Rn. 113 f.).
20Das Handelsregister hat zwei Abteilungen:
– Abteilung Afür Einzelkaufleute und Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG) sowie die sie betreffenden Rechtstatsachen;
– Abteilung Bfür Kapitalgesellschaften sowie die sie betreffenden Rechtstatsachen.
Nach Maßgabe des § 10 HGB sind Eintragungen in das Handelsregister auch bekannt zu machen. Als öffentlichem Verzeichnis kommt dem Handelsregister eine Publizitätsfunktionzu (s. § 15 HGB; dazu noch eingehend Rn. 216 ff.).
21Die Eintragung in das Handelsregister hat in der Regel nur deklaratorischeWirkung, d. h. die mit der Eintragung und Bekanntmachung publizierte Rechtstatsache tritt materiell-rechtlich auch ohne die Eintragung ein. In bestimmten Fällen wirkt die Eintragung aber auch konstitutiv,so etwa bei der Gründung einer GmbH (s. § 11 Abs. 1 GmbHG), AG (s. § 41 Abs. 1 Satz 1 AktG) oder SE (s. Art. 16 Abs. 1 SE-VO): Die Kapitalgesellschaft entsteht als juristische Person jeweils erst mit ihrer Handelsregistereintragung.
22Seit Inkrafttreten des Gesetzes über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) 23am 1.1.2007 wird das Handelsregister elektronischgeführt und erfolgen auch die Bekanntmachungen elektronisch. Für die elektronischen Bekanntmachungen haben die Bundesländer ein gemeinsames Internetportal eingerichtet ( www.handelsregister.de).
§ 2Der Kaufmannsbegriff des HGB
→ Lsg. Fall 1 Rn. 423
Fall 1:
Der Malermeister Malte Marder (M) betreibt ein Malerunternehmen, in dem außer M selbst nur der bei ihm angestellte Malergeselle Gunter Gans (G) tätig ist. Im Handelsregister ist M auf seinen Antrag mit der Firma „Malerei Marder e. K.“ eingetragen. M führt Maler- und Tapezierarbeiten überwiegend bei privaten Kunden in deren Wohnungen und gelegentlich auch in den Büro- oder Gewerberäumen von Geschäftskunden aus. Der jährliche Umsatz des Malerunternehmens beträgt im Durchschnitt etwa 100.000 €. Farbe, Tapete und sonstiges Material erwirbt M stets in einem der örtlichen Baumärkte. Die Buchhaltung erledigt M selbst.
Читать дальше