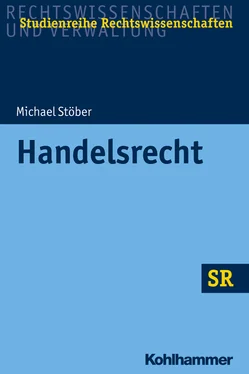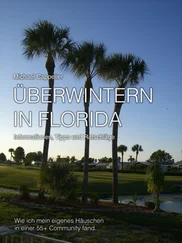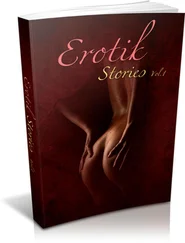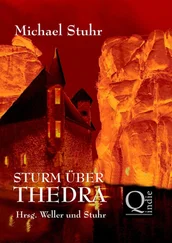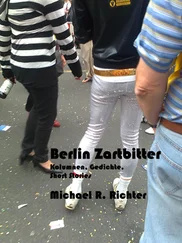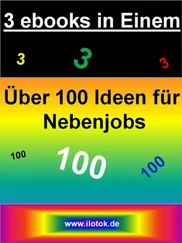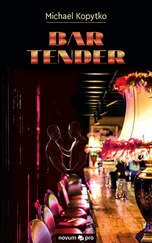Von dem mit ihm befreundeten Karl Kater (K), der Inhaber eines kleinen Obst- und Gemüseladens ist, wird M mit dem Neuanstrich des Ladenlokals des K beauftragt. Der jährliche Umsatz des Ladens beläuft sich auf ca. 80.000 €. K hat keine Angestellten und erledigt die Buchhaltung ebenfalls selbst. Obst und Gemüse bezieht K von einem Großhändler im Nachbarort. Im Handelsregister ist K nicht eingetragen. Nach Abschluss der Malerarbeiten überbringt M dem K am 2. April eine Rechnung über den vereinbarten Werklohn von 1.500 €. Bei der Entgegennahme der Rechnung äußert K, dass er mit der Arbeit des M rundum zufrieden sei. Gleichwohl zahlt K den Rechnungsbetrag monatelang nicht. Mit Rücksicht auf die langjährige Freundschaft sieht M davon ab, bei K nachzufragen. Am 2. August überweist K dann schließlich doch die 1.500 €. Verärgert über die späte Zahlung verlangt M von K nunmehr die Zahlung von Zinsen aus dem Rechnungsbetrag von 1.500 € ab dem 2. April. Zu Recht?
I.Bedeutung des Kaufmannsbegriffs
23Wie bereits ausgeführt wurde (s. Rn. 9 ff.), ist das Handelsrecht das Sonderprivatrecht der Kaufleute. Dem HGB liegt das subjektive Systemzugrunde; die Sondervorschriften des Handelsrechts finden im Grundsatz nur auf Rechtssubjekte Anwendung, die nach Maßgabe der §§ 1 ff. HGB Kaufleute sind. Bei natürlichen Personen unterscheidet das Gesetz zwischen Ist-Kaufleuteni. S. d. § 1 HGB (grundsätzlich jeder Gewerbetreibende; dazu Rn. 24 ff.) und Kann-Kaufleuteni. S. d. §§ 2, 3 HGB (Kleingewerbetreibende sowie Land- und Forstwirte; dazu Rn. 46 ff.). Als Kaufleute anzusehen sind nach § 6 Abs. 1 HGB auch Personenhandelsgesellschaften, also die OHG (§§ 105 ff. HGB) und die KG (§§ 161 ff. HGB; dazu Rn. 53 f.). Zudem sind bestimmte juristische Personen, insbesondere Kapitalgesellschaften, kraft ihrer Rechtsform Kaufleute (sog. Formkaufleute,s. § 6 Abs. 2 HGB; dazu Rn. 55 f.). Hinzu kommen die in § 5 HGB geregelten Fiktivkaufleute(dazu Rn. 57 ff.) sowie die gewohnheitsrechtlich anerkannte Rechtsfigur des Scheinkaufmanns(dazu Rn. 65 ff.).
Im Fall 1war M lediglich mit Anstreicharbeiten beauftragt, die weder als Umbauarbeiten i. S. d. § 650a Abs. 1 Satz 1 BGB noch als Instandhaltungsarbeiten i. S. d. § 650a Abs. 2 BGB angesehen werden können. Es handelte sich daher nicht um einen Bauvertrag gem. § 650a BGB, sondern um einen allgemeinen Werkvertrag gem. § 631 BGB. Aus diesem ist dem M eine Werklohnforderung gegen K in Höhe von 1.500 € erwachsen (§ 631 Abs. 1 BGB). Hinsichlich des Werklohns hat M dem K keine Mahnung erteilt. Nach den allgemeinen Vorschriften des BGB kann M erst nach Ablauf von 30 Tagen nach dem am 2. April erfolgten Zugang seiner Rechnung bei K und somit erst ab dem 3. Mai Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 1.500 € verlangen (s. § 288 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 i. V. m. § 286 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 BGB).
§ 353 Satz 1 HGBgewährt Kaufleuten untereinander jedoch in Bezug auf Geldforderungen aus beiderseitigen Handelsgeschäften einen Anspruch auf Fälligkeitszinsen.Dieser besteht ab dem ersten Tag der Fälligkeit der Hauptforderung. 24Die Fälligkeit der Werklohnforderung des M gegen K ist gem. § 641 Abs. 1 Satz 1 BGB mit der Abnahme der Malerarbeiten durch K am 2. April eingetreten. M kann also von K schon ab dem 2. April Zinsen in Höhe von 5 % pro Jahr (s. § 352 Abs. 2 HGB) aus 1.500 € verlangen, wenn sowohl M als auch K Kaufmannist.
II.Ist-Kaufmann und Gewerbebegriff (§ 1 HGB)
1.Überblick
24Ausgangsnorm für die Bestimmung der Kaufmannseigenschaft natürlicher Personenist § 1 HGB. Nach § 1 Abs. 1 HGB ist Kaufmann, wer ein Handelsgewerbebetreibt. Ein Handelsgewerbe ist nach § 1 Abs. 2 Halbs. 1 HGB grundsätzlich jeder Gewerbebetrieb.Im Grundsatz ist also jeder Gewerbetreibende Kaufmann.
25Für die Bestimmung des subjektiven Anwendungsbereichs des HGB kommt damit dem Begriff des Gewerbeseine zentrale Bedeutung zu. Allerdings enthält das HGB keine Legaldefinitiondes Gewerbebegriffs. Wohl aber findet sich eine Definition des Gewerbebetriebs in § 15 Abs. 2 Satz 1, 3 EStG. Nach dieser Vorschrift ist ein Gewerbebetrieb jede selbstständige nachhaltige Betätigung, die mit der – zumindest als Nebenzweck verfolgten – Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird, sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt und weder als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft noch als Ausübung eines freien Berufs noch als eine andere selbstständige Arbeit anzusehen ist. 25Freilich kann die Legaldefinition des § 15 Abs. 2 Satz 1, 3 EStG nicht einfach für das Handelsrecht übernommen werden; denn sie dient der Abgrenzung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb von anderen Einkunftsarten für Zwecke der Einkommenbesteuerung und stellt daher eine spezifisch steuerrechtliche Begriffsbestimmung dar. 26
26Für das Handelsrecht haben Rechtsprechung und Schrifttum jedoch eine Definition des Gewerbebegriffs entwickelt, die der des § 15 Abs. 2 Satz 1, 3 EStG sehr ähnlich ist und heute weitgehend als gewohnheitsrechtlich anerkannt angesehen werden kann. Danach ist ein Gewerbeim handelsrechtlichen Sinne jede
– erlaubte (str.),
– nach außen in Erscheinung tretende,
– selbstständige,
– planmäßig auf gewisse Dauer
– mit Gewinnerzielungsabsicht ausgeübte Tätigkeit (str.),
– die nicht freier Beruf, künstlerische oder wissenschaftliche Betätigung oder Urproduktion (Land- oder Forstwirtschaft) ist. 27
2.Erfordernis einer erlaubten Tätigkeit?
27Nach der traditionellen Ansicht muss es sich um eine erlaubte,also um eine solche Tätigkeit handeln, die auf den Abschluss wirksamer Verträge gerichtet ist. 28Hieran fehlt es bei einer gesetz- oder sittenwidrigen Tätigkeit (§§ 134, 138 BGB), etwa dem gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßenden Handel mit Drogen oder dem ohne die nach dem Waffengesetz erforderliche Waffenhandelserlaubnis betriebenen Handel mit Schusswaffen oder Munition. Nach der Gegenansicht, die u. a. auf § 7 HGB verweist, steht es der Einordnung als Gewerbe jedoch nicht entgegen,dass die Tätigkeit gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstößt. 29Für die letztere Ansicht spricht, dass es keinen Grund gibt, denjenigen, der einer gesetz- oder sittenwidrigen Tätigkeit nachgeht, gleichsam zu privilegieren, indem man ihn aus dem Kaufmannsbegriff herausfallen lässt und ihn so von den strengeren Pflichten und Obliegenheiten für Kaufleute entbindet.
3.Nach außen in Erscheinung tretende Tätigkeit
28Unstreitig kann nur eine nach außen in Erscheinung tretende Tätigkeitunter den Gewerbebegriff fallen. Die betreffende Person muss sich erkennbar auf einem für sie externen Markt betätigen. Hieran fehlt es beispielsweise bei einem für Dritte nicht sichtbaren Spekulieren mit eigenem Kapital an der Börse oder bei der bloßen Verwaltung eigenen Vermögens, etwa dem Halten von Aktien oder GmbH-Anteilen. 30
4.Selbstständige Tätigkeit
29Ebenfalls unstreitig muss es sich um eine selbstständige Tätigkeithandeln. Dabei kommt es auf die rechtliche,nicht auf die wirtschaftliche Selbstständigkeit an. 31Unter Heranziehung der für das Handelsvertreterrecht geltenden Legaldefinition des § 84 Abs. 1 Satz 2 HGB wird als (rechtlich) selbstständig angesehen, wer im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. 32Ob eine rechtliche Selbstständigkeit in diesem Sinne besteht, ist unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach dem Gesamtbildder Verhältnisse zu beurteilen, wie es sich aus der vertraglichen Gestaltung und der tatsächlichen Handhabungergibt. 33Wenn die tatsächliche Handhabung allerdings von der vertraglichen Vereinbarung abweicht, ist Erstere entscheidend. 34
Читать дальше