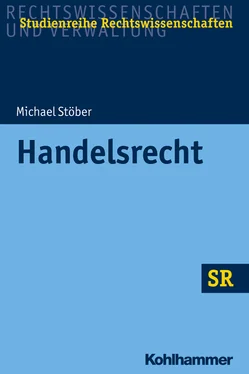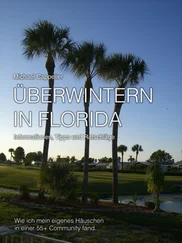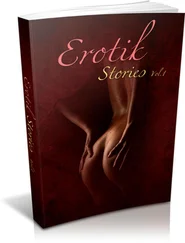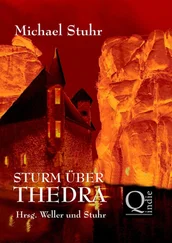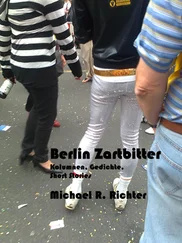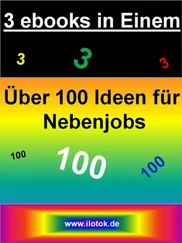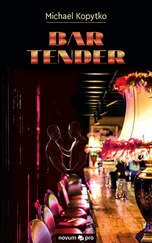59§ 5 HGB ist ohne Rücksicht darauf anwendbar, ob von demjenigen, der sich auf die Eintragung beruft, tatsächlich Einsicht in das Handelsregister genommen worden ist. Allerdings knüpft § 5 HGB an die zumindest abstrakte Möglichkeit einer Einsichtnahmein das Handelsregister und deren – ebenfalls abstrakte – Kausalität für das anschließende Verhalten der betreffenden Person im Rechtsverkehr an. Eine solche abstrakte Kausalität der Einsichtnahme in das Handelsregister für das Verhalten im Rechtsverkehr ist aber von vornherein nur im rechtsgeschäftlichen Bereich denkbar, nicht dagegen im Bereich deliktischer oder sonstiger gesetzlicher Haftungstatbestände, die keinen Bezug zum rechtsgeschäftlichen Verkehr haben, etwa im Falle eines Unfalls im Straßenverkehr. Zu Recht beschränkt die h. M. den sachlichen Anwendungsbereich des § 5 HGB daher auf – vertragliche und gesetzliche – Ansprüche, die im Zusammenhang mit dem rechtsgeschäftlichen Verkehrstehen. 95
60Aufgrund der Parallelen, die § 2 HGB einerseits und § 5 HGB andererseits sowohl hinsichtlich des Tatbestands (Eintragung im Handelsregister) als auch hinsichtlich der Rechtsfolgen (Behandlung des Eingetragenen als Kaufmann) aufweisen, nimmt die wohl h. M.an, dass § 5 HGB neben der durch das Handelsrechtsreformgesetz von 1998 96neu gefassten Vorschrift des § 2 HGB keinen eigenen Anwendungsbereichmehr habe und daher überflüssig sei. 97Dabei geht die h. M. davon aus, dass § 5 HGB – ebenso wie § 2 HGB – voraussetzt, dass ein Gewerbebetrieben wird; 98nach der h. M. wird ein nichtgewerbliches Unternehmen also weder von § 2 HGB noch von § 5 HGB erfasst.
61Dagegen will K. Schmidt § 5 HGB auch dann anwenden, wenn ein nichtgewerbliches– etwa freiberufliches oder künstlerisches – Unternehmen im Handelsregister eingetragen ist. 99Eine weitere Ansicht verlangt zwar auch für § 5 HGB ein gewerbliches Unternehmen, schreibt der Vorschrift aber insofern einen eigenen Anwendungsbereich zu, als § 5 HGB im Unterschied zu § 2 HGB auch dann eingreife, wenn der Handelsregistereintragung keine wirksame Anmeldungzugrunde liege oder ein Handelsgewerbe i. S. d. § 1 HGB nach der Handelsregistereintragung zu einem Kleingewerbe i. S. d. § 1 Abs. 2 Halbs. 2 HGB absinke. 100
62Die letztere Auffassung erscheint vorzugswürdig. Wie dargelegt wurde (s. Rn. 47), ist für § 2 HGBzu fordern, dass der Handelsregistereintragung eine wirksame Anmeldungdes Unternehmensinhabers zugrunde liegt. Denn § 2 HGB setzt implizit voraus, dass der Inhaber eines kleingewerblichen Unternehmens willentlich von der ihm eingeräumten Eintragungsoption Gebrauch gemacht hat. Demgegenüber knüpft § 5 HGBgerade nicht an eine willentliche Entscheidung des Unternehmensinhabers an und erfasst damit auch jene Fälle, in denen die Firma des Unternehmens ohne wirksame Anmeldungdes Inhabers im Handelsregister eingetragen worden ist. Insoweit hat § 5 HGB also durchaus einen eigenen Anwendungsbereich. Demgegenüber widerspräche es der bewussten Entscheidung des Gesetzgebers, die Kaufmannseigenschaft bei natürlichen Personen auf gewerbliche Unternehmer zu beschränken, wenn man § 5 HGB mit K. Schmidt auch auf nichtgewerbliche Unternehmer anwenden würde. Auch § 5 HGB kann daher nur eingreifen, wenn das eingetragene Unternehmen überhaupt ein Gewerbedarstellt.
Im Fall 3ist L zwar nach wie vor mit seiner Firma im Handelsregister eingetragen. Allerdings betreibt L jetzt kein Bestattungsinstitut und damit kein Gewerbei. S. d. § 1 HGB mehr, sondern geht der Bildhauerei und damit einer künstlerischen Tätigkeit nach, die vom Gewerbebegriff des § 1 HGB nicht erfasst wird (s. Rn. 34 ff.). Mangels gewerblichen Unternehmens ist daher § 2 HGB und nach h. M. auch § 5 HGB nicht anwendbar. Möglicherweise muss L sich aber nach § 15 Abs. 1 HGB als Kaufmann behandeln lassen.
2.Kaufmann kraft negativer Publizität des Handelsregisters (§ 15 Abs. 1 HGB)
63§ 15 Abs. 1 HGB regelt die sog. negative Publizität des Handelsregisters(eingehend dazu noch u. Rn. 216 ff.). Nach dieser Vorschrift kann eine in das Handelsregister einzutragende Tatsache einem gutgläubigen Dritten von demjenigen, in dessen Angelegenheiten die Tatsache einzutragen war, nicht entgegengehalten werden. Derjenige, in dessen Angelegenheiten die Tatsache einzutragen war, muss sich also gegenüber einem gutgläubigen Dritten so behandeln lassen, als sei die betreffende Tatsache nicht eingetreten. Die Rechtsfolge des § 15 Abs. 1 HGB tritt unter folgenden Voraussetzungen ein:
1. Es muss sich um eine eintragungspflichtigewahre Tatsache handeln.
2. Die Tatsache gehört zu den Angelegenheitendesjenigen, der sich auf die betreffende Tatsache beruft.
3. Die Tatsache ist nicht eingetragen und auch nicht bekannt gemachtworden.
4. Der Dritte darf keine positive Kenntnisvon der betreffenden Tatsache haben.
5. Das vom Dritten geltend gemachte Recht muss seine Grundlage im Geschäftsverkehrund nicht im Unrechtsverkehr haben, also auf rechtsgeschäftlichem und nicht auf deliktischem Verhalten beruhen (h. M.).
64Eine eintragungspflichtige Tatsache i. S. d. § 15 Abs. 1 HGB ist gem. § 31 Abs. 2 Satz 1 HGBauch das Erlöschen der Firmainfolge Verlusts der Kaufmannseigenschaft. Weil nur Kaufleute eine Firma haben (s. § 17 HGB), erlischt mit dem Wegfall der Kaufmannseigenschaft auch die Firma. Versäumt es der Inhaber des betreffenden Unternehmens, das Erlöschen der Firma zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, muss er sich unter den weiteren Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 HGB gegenüber gutgläubigen Dritten weiterhin als Kaufmann behandeln lassen.
Im Fall 3ist mit der Einstellung des Betriebs des Bestattungsunternehmens und der Aufnahme einer künstlerischen Tätigkeit das Handelsgewerbe des L weggefallen. Weil eine Firma nur für ein Handelsgewerbe geführt werden kann, ist damit auch die Firma erloschen.Das Erlöschen der Firma stellt nach § 31 Abs. 2 Satz 1 HGBeine eintragungspflichtige Tatsachedar. Da L Inhaber sowohl des Bestattungsunternehmens als auch der Firma war, gehört das Erlöschen der Firma zu seinen Angelegenheiten. Das Erlöschen der Firma ist jedoch nicht in das Handelsregister eingetragen und auch nicht bekannt gemacht worden.
V ging davon aus, das Bestattungsunternehmen bestehe nach wie vor, und hatte somit keine positive Kenntnisvom Erlöschen der zugehörigen Firma. Die Forderung des V beruht auf einem Bürgschaftsvertrag und damit auf einem Rechtsgeschäft. Nach § 15 Abs. 1 HGB kann L sich daher gegenüber dem gutgläubigen V nicht darauf berufen, dass sein Handelsgewerbe und mit ihm die Firma erloschen ist; vielmehr gelten beide gem. § 15 Abs. 1 HGB als fortbestehend. Folglich muss L sich nach § 15 Abs. 1 HGB nach wie vor als Kaufmann behandeln lassen.
Die Bürgschaft hat L übernommen, um eine Vernissage mit den von ihm in seinem künstlerischen Betrieb hergestellten Skulpturen zu ermöglichen. Die Bürgschaft gehört somit zum Betrieb des Unternehmens des als Kaufmann geltenden L und stellt daher für diesen ein Handelsgeschäftdar (§ 343 Abs. 1 HGB). Nach § 350 HGB ist die Formvorschrift des § 766 Satz 1 BGB mithin auf den Bürgen L nicht anwendbar. Die von ihm per E-Mail übernommene Bürgschaftist folglich nicht nach § 125 Satz 1 i. V. m. § 766 Satz 1 BGB formnichtig, sondern wirksam.V kann daher von L nach § 765 Abs. 1 i. V. m. § 535 Abs. 2 BGB die Begleichung der Mietschulden der G von 5.000 € verlangen.
Читать дальше