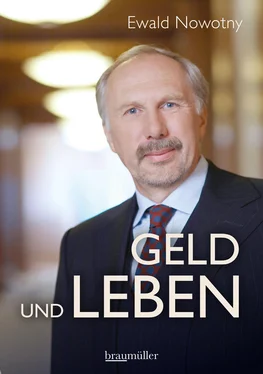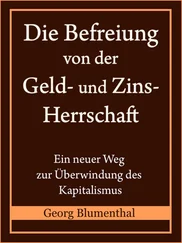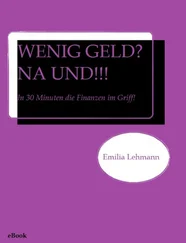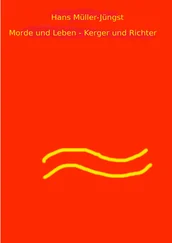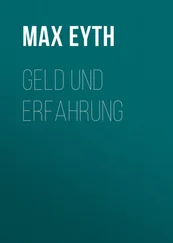Ewald Nowotny - Geld und Leben
Здесь есть возможность читать онлайн «Ewald Nowotny - Geld und Leben» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Geld und Leben
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Geld und Leben: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Geld und Leben»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Geld und Leben — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Geld und Leben», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Es gibt in Österreich erfreulicherweise keine unmittelbare finanzielle Barriere für ein ordentlich durchgeführtes Studium – sehr wohl aber deutliche finanzielle Barrieren für das Erlangen jener wichtigen Zusatzqualifikationen – wie Auslandsaufenthalte, Spezialkurse und vor allem interessante Praktika – die für einen weiteren Karriereverlauf oft von größter Bedeutung sind. Hier sehe ich die Gefahr, dass es auch im Bereich der akademischen Ausbildung zu einer Zweiklassengesellschaft kommt; zwischen einer bestens ausgebildeten, international mobilen und vernetzten Elite und den „normalen“, lokal orientierten Absolventinnen und Absolventen. Ich habe speziell im Finanzbereich gesehen, dass bei Postenvergaben auch nach objektiven Kriterien diese Elite einen meist nicht aufholbaren Vorsprung hat – und damit indirekt wieder eine Form der sozialen Selektion auftritt. Bezüglich der Berücksichtigung von Minderheitengruppen arbeiten amerikanische Universitäten – vielfach durchaus umstritten – mit Quotensystemen, und es gibt auch großzügige Stipendien für Doktorandinnen und Doktoranden. Im europäischen Kontext wird dieser Aspekt einer sozialen Chancengleichheit im gehobenen Ausbildungsbereich – etwa auch beim Zugang zu teuren Top-Business Schools – zwar diskutiert, ich kenne aber noch wenige konkrete Bemühungen, dieses Problem zu entschärfen.
12Vgl.: Egon Matzner, Ewald Nowotny (Hrsg.): Was ist relevante Ökonomie heute? Festschrift für Kurt W. Rothschild. Metropolis, Marburg 1994.
13Reinhold Mitterlehner: Haltung: Flagge zeigen in Leben und Politik. Ecowin, Salzburg 2019.
14Ewald Nowotny: Wirtschaftspolitik und Umweltschutz. Rombach, Freiburg im Breisgau 1974.
15Ewald Nowotny: Inflation and Taxation. Reviewing the Macroeconomic Issues. In: Journal of Economic Literature 1980, Vol. 18: 1025ff.
16Ewald Nowotny: Regionalökonomie – Eine Übersicht über Entwicklung, Probleme und Methoden. Springer Verlag, Wien-New York, 1971.
17Béla J. Löderer, Ewald Nowotny: Oberösterreich 1980 – Eine Untersuchung der Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft und Landesfinanzen. Europa Verlag, Wien, 1969.
5.Gedanken zu Theorie und Praxis
Wirtschaftspolitik – und ganz speziell Geld- und Währungspolitik – ist wesentlich bestimmt von den theoretischen Vorstellungen, die dem Handeln der Akteure (und leider seltener: Akteurinnen) zugrunde liegen. Wobei diesen Akteuren vielfach nicht bewusst ist, auf welchen, ihnen selbst „verborgenen“ Vorstellungen ihr konkretes Handeln beruht. John Maynard Keynes, ein bis heute unerreichtes Beispiel einer produktiven Verbindung von Theorie und Praxis, hat dies zu Ende seiner bahnbrechenden „Allgemeinen Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ plastisch formuliert: „Die Gedanken der Ökonomen und Staatsphilosophen, sind sowohl wenn sie im Recht, als wenn sie im Unrecht sind, einflussreicher, als gemeinhin angenommen wird. Die Welt wird in der Tat durch nicht viel anderes beherrscht. Praktiker, die sich ganz frei von intellektuellen Einflüssen glauben, sind gewöhnlich die Sklaven irgendeines verblichenen Ökonomen. Wahnsinnige in hoher Stellung, die Stimmen in der Luft hören, zapfen ihren wilden Irrsinn aus dem, was irgendein akademischer Schreiber ein paar Jahre vorher verfasste. Ich bin überzeugt, dass die Macht erworbener Rechte im Vergleich zum allmählichen Durchringen von Ideen stark übertrieben wird. Diese wirken zwar nicht immer sofort, sondern nach einem gewissen Zeitraum; denn im Bereich der Wirtschaftslehre und der Staatsphilosophie gibt es nicht viele, die nach ihrem fünfundzwanzigsten oder dreißigsten Jahr durch neue Theorien beeinflusst werden, sodass die Ideen, die Staatsbeamte und Politiker und selbst Agitatoren auf die laufenden Ereignisse anwenden, wahrscheinlich nicht die neuesten sind. Aber früher oder später sind es Ideen, und nicht erworbene Rechte, von denen die Gefahr kommt, sei es zum Guten oder zum Bösen.“ 18
Auch heute gilt, dass wirtschaftspolitisches Handeln oft auf – den Handelnden wohl unbewussten – ökonomischen Theorien beruht, die manchmal vor Hunderten Jahren entwickelt wurden, wie etwa das Verhalten eines amerikanischen Präsidenten zeigt, dessen Betonung des wirtschaftlichen Protektionismus den Ansätzen des im 17. Jahrhundert entwickelten „Merkantilismus“ entspricht. Der Bereich der Geld- und Wirtschaftspolitik ist wohl am engsten und aktuellsten mit der Entwicklung wirtschaftswissenschaftlicher Theorien verbunden. Dies zeigt sich auch daran, dass sämtliche Notenbanken über umfangreiche volkswirtschaftliche Abteilungen verfügen und vielfach auch entsprechende Publikationen herausgeben.
Generell sind die Wirtschaftswissenschaften heute ein inhaltlich und methodisch breit ausgebautes und spezialisiertes Feld der Forschung, Lehre und Anwendung, mit entsprechend großen Differenzierungen. Diese Differenzierungen beruhen im Wesentlichen auf Unterschieden in theoretischen und gesellschaftspolitischen Ausgangslagen. Beispiele sind etwa die Unterschiede zwischen makroökonomisch, das heißt gesamtwirtschaftlich orientierten Vertretern einer „keynesianischen Position“ im Gegensatz zu Vertretern einer stärker mikroökonomisch, das heißt auf Einzelverhalten basierten „Angebots-orientierten“ Ökonomie. Es gibt aber gemeinsame „Denkmodelle“, die in vielen Aspekten gar nicht „spezifisch ökonomisch“ sind, sondern etwa dem „gesunden Hausverstand“, dem „Common Sense“ entsprechen. Gleichzeitig gibt es Beispiele, wo etwa die Sicht der „schwäbischen Hausfrau“ wichtige gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge außer Acht lässt. In vielen Fällen können sich jedenfalls massive Unterschiede im „typischen Herangehen“ von Ökonomen und Nicht-Ökonomen ergeben. Ich habe das in meiner Lebenspraxis, speziell als Wirtschaftspolitiker, vielfach bemerkt und mich bemüht, als Lehrender meine Studentinnen und Studenten auf diese Herausforderungen vorzubereiten. Im Folgenden einige wichtige Beispiele eines „spezifisch ökonomischen Denkens“ und entsprechender wirtschaftspolitischer Perspektiven.
Denken in Nutzen und Kosten
Oskar Wilde spottete, „ein Ökonom ist jemand, der von allem den Preis, aber von nichts den Wert kennt“. Nun gibt es eine – generell in der „Österreichischen Schule der Nationalökonomie“ zwar lange, wenn auch nicht sehr fruchtbare – Diskussion über die Zusammenhänge von Werten und Preisen. In der Praxis ist es freilich richtig, dass bei Nutzen/ Kosten-Überlegungen überwiegend auf Preise (zum Teil auch auf konstruierte „Schattenpreise“) abgestellt wird. Zentral ist aber jedenfalls für Ökonomen, bei Vorschlägen stets beide Seiten – Nutzen und (!) Kosten – zu betrachten. Meine politischen Erfahrungen zeigen dagegen, dass die gesellschaftspolitische Dynamik dann am größten ist, wenn sie sich in der öffentlichen Diskussion nur auf die Nutzenseite einer Maßnahme bezieht und die Kostenseite außer Acht lässt oder bagatellisiert. Dies führt dann zur Positionierung „es gibt keine Alternative“ beziehungsweise „das muss wohl noch drin sein“. Nun ist es speziell über lange Zeiträume hinweg zweifellos oft schwierig, umfassend „Nutzen“ beziehungsweise „Kosten“ zu quantifizieren – aber es hilft zweifellos für eine rationale Diskussion, sich um eine umfassende Analyse der entsprechenden Zusammenhänge zu bemühen. Dies reicht von „großen Fragen“, wie etwa der Umweltpolitik, bis zu „kleinen Fragen“, wie etwa der Schaffung einer neuen Stelle in der öffentlichen Verwaltung.
Für Notenbanken stellen sich „Kosten/Nutzen-Überlegungen“ sowohl bei den „großen Fragen“ der Geld- und Währungspolitik, wie auch bei den vielfältigen Aspekten der Regulierung und Bankenaufsicht. Es gab und gibt in der Tat eine intensive Diskussion etwa von Nutzen und Kosten einer Politik niedriger Zinssätze. Dabei gibt es Übereinstimmung, dass eine solche Politik zur unmittelbaren Krisenbekämpfung notwendig und sinnvoll war und ist. Nicht so eindeutig sind freilich die Nutzen/Kosten-Bewertungen bei langfristiger Fortführung einer solchen Politik. Dabei gibt es innerhalb einer Institution meist eine – überwiegend „Modell-bestimmte“ – „herrschende Lehre“, sodass die entsprechenden Diskussionen weniger innerhalb einer Institution, als eher zwischen einzelnen Institutionen stattfinden. Konkret in den vergangenen Jahren etwa zwischen der EZB, als Vertreterin einer expansiven Geldpolitik, und der BIZ, der „Bank der Zentralbanken“ in Basel, deren Ökonomen vor zunehmenden „Nebenwirkungen“, das heißt volkswirtschaftlichen Kosten einer expansiven Geldpolitik warnen. Hier ist es für Entscheidungsträger, konkret Gouverneurinnen und Gouverneure, m. E. wichtig, sich selbständig zu informieren und eine eigene Meinung zu bilden – was freilich entsprechende wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse erfordert. Problematisch erscheint es mir aber, wenn solche Überlegungen Gegenstand von Gerichtsverfahren werden, wie dies beim deutschen Bundesverfassungsgericht der Fall war, worauf in Kapitel 15noch eingegangen wird.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Geld und Leben»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Geld und Leben» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Geld und Leben» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.