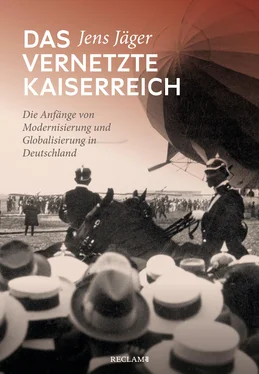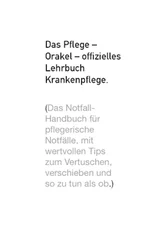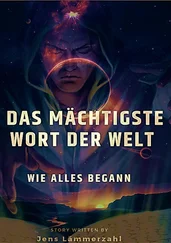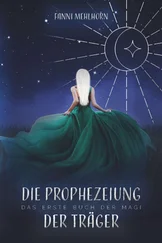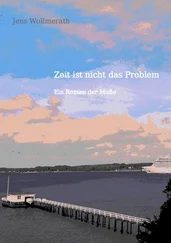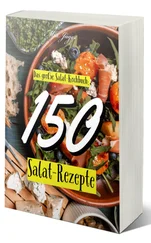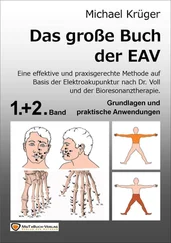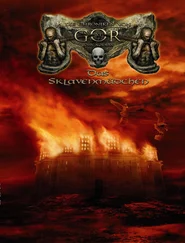Dementsprechend bestanden in Europa am Vorabend der Reichsgründung von 1871 sehr unterschiedliche Staatsgebilde. Zunächst gab es mehrsprachige und geographisch eher kleine Staaten wie die Schweiz, das Königreich Belgien oder das Großherzogtum Luxemburg. Dagegen erschienen Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Portugal, Schweden, Dänemark, die Niederlande und Griechenland eher als homogene Nationen – was aber keineswegs bedeutete, dass innerhalb dieser Staaten nicht zuweilen große sprachliche und/oder kulturelle Unterschiede bestanden. Letztere waren wiederum geradezu kennzeichnend für das Kaiserreich Österreich-Ungarn und schließlich sich weit über Europa hinaus erstreckende multi-ethnische und vielsprachige Gebilde wie das Osmanische oder das Russische Reich.
Gemeinsam war all diesen Staaten jedoch, dass sie sich historisch zu legitimieren suchten und sich administrativ möglichst klar von den anderen abgrenzten. Dazu gehörte die Grenzsicherung gegenüber Personen und Dingen ebenso wie angesichts neuer Ideen, wobei Letzteres überaus schwierig bis überhaupt nicht zu bewerkstelligen war. Ferner war zu definieren und rechtlich zu kodifizieren, wer Angehöriger des Staates war und wer nicht. Auch die Statistik, die im 19. Jahrhundert einen außerordentlichen Aufschwung nahm, orientierte sich an den Staatsgrenzen und fasste ihre Erkenntnisse stets für ein Staatsgebiet zusammen, differenziert nach administrativen Einheiten.
Rechts- und Wirtschaftsordnung schufen einen Binnenraum, der das Handeln der Bevölkerung rahmte und bestimmte. All dies signalisierte den Zeitgenossen die Eigenständigkeiten nationaler Entwicklungen und lud zu ständigen Vergleichen mit den Nachbarn ein. Bestimmend war der Blick durch die »nationale« Brille; ein Blick, der lange Zeit und teils bis in die Gegenwart auch die Geschichtswissenschaft bestimmte. Deutsche Geschichte zu schreiben bedeutete, eine Innenperspektive einzunehmen, und das hieß auch, dass man alle Entwicklungen, ob politisch, ökonomisch, sozial, wissenschaftlich oder kulturell, vornehmlich aus dieser Perspektive betrachtete. Einflüsse von »außen« nahm man zwar wahr, beschrieb sie aber kaum je als treibende oder entscheidende Faktoren. Das hatte durchaus seine Berechtigung, weil der Staat die Rahmenbedingungen setzte und sich die Bevölkerung innerhalb dieses Rahmens bewegte und handelte. Impulse von »außen« wurden von inländischen Akteuren verarbeitet und in Debatten eingespeist; nur auf diese Weise schlugen sie sich in den Quellen nieder. Diese scheinbar klare Trennung zwischen »innen« und »außen« ist bei näherer Betrachtung alles andere als zwingend, da vielfältige offene und unterschwellige, kurz- und langfristige Prozesse unauflöslich miteinander vermengt sind. Gerade unter der Bedingung zunehmend vernetzter Kommunikation sind durchgängig und ausschließlich lokale Lösungen von Problemen eher die Ausnahme als die Regel.
In den vergangenen Jahrzehnten sind transnationale und globale Perspektiven entstanden, die dieses Phänomen in der Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts zu Deutschland verdeutlichen. Verflechtungen sind nicht dadurch weniger relevant, dass sie über Staatsgrenzen hinausreichen. Wenn es um Ideen- oder Ideologiegeschichte geht, war das auch immer offensichtlich: Liberalismus, Konservatismus und Marxismus beispielsweise sind niemals rein nationale Phänomene gewesen, wenngleich sie unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen jeweils spezifische Ausprägungen und Konsequenzen hatten. Politische Bewegungen entfalten sich immer in einem internationalen Austausch.
Ebenso sind wirtschaftliche Verflechtungen unter den Bedingungen der Globalisierung überaus weitreichend – Weltmarktpreise für Agrarprodukte wirken auf exportorientierte Landwirte ebenso ein wie auf Kleinbauern und haben für alle Konsumenten Konsequenzen, selbst beim Einkauf auf dem örtlichen Wochenmarkt. Der Vorwärts rechnete z. B. 1900 vor: »Die Entwicklung der Preise [für Getreide] hängt auch in Deutschland von der Lage des Weltmarkts ab« und kritisierte nach längeren statistischen Betrachtungen zu Durchschnittspreisen auf wichtigen deutschen Getreidemärkten, dass die deutschen Getreidezölle (die es ab 1879 gab) »dem deutschen Brotverbraucher« stets unnötig hohe Preise bescheren würden.7
Das Deutsche Kaiserreich von 1871 ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch den immensen Ausbau der Infrastruktur und die zunehmende Verfügbarkeit von Medien, kurz: die immer stärkere Vernetzung der Gesellschaft, immer weniger »autonom« blieb. D. h., es wurde von mehr oder weniger entfernten Prozessen abhängig, selbst wenn die Zeitgenossen das so nicht wahrnahmen. Das weitverbreitete nationale Konkurrenzdenken im Hinblick auf Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur unterstreicht das nur – denn Konkurrenz setzt ja voraus, dass man etwas über jene erfährt, mit denen man sich im Wettbewerb wähnt.
Bereits bestehende Verknüpfungen wurden ausgebaut; neue Möglichkeiten kamen hinzu. Netzwerke konnten tendenziell räumlich immer weitläufiger und in sich immer enger werden, so dass persönliche Kontakte intensiver gepflegt werden. Nicht zu unterschätzen sind jene Verbindungen, die sich aus den Medien ergaben. Mit der stetigen Ausweitung des Pressewesens und Buchhandels gelangten immer mehr Informationen aus der Ferne zum lesenden Publikum, das zugleich ein schauendes Publikum war, weil die Verbreitung von Bildern aller Art ebenfalls stetig zunahm. Darin liegt der Kern des 1983 von dem amerikanischen Politikwissenschaftler Benedict Anderson geprägten Begriffs der »vorgestellten Gemeinschaft« ( imagined community ). Eine solche kann nur existieren, weil Medien die ihr zugrunde liegenden Vorstellungen verbreiten. Anders ausgedrückt: Je weiter sich Medien verbreiten und je umfangreicher ihr Angebot wird, desto größere Gruppen können solche Vorstellungen teilen und mitgestalten. Allerdings entwerteten neue »vorgestellte Gemeinschaften« keineswegs die bestehenden, ebenso wenig verhinderten sie, dass parallel andere Gemeinschaften entstanden.
Konkret für das Deutsche Kaiserreich bedeutet dies, dass der neu entstandene Staat eben nicht die bestehenden Gemeinschaften ersetzte, sondern eine zusätzliche schuf – freilich eine, die besondere Loyalität forderte und die bestehenden überwölbte. Der Akt der Staatsgründung war erst der Beginn einer Entwicklung, die weder sofort noch konfliktfrei erfolgte. Auch war ja der neue Staat ausdrücklich als ein Bund souveräner Einzelstaaten nach dem Muster des Norddeutschen Bundes von 1867 und dessen Erweiterung 1870 gegründet worden. Wie damals blieben auch 1871 die jeweiligen Staatsangehörigkeiten erhalten, wenngleich diese von allen anderen Ländern des Kaiserreichs als gleichwertig zur eigenen Staatsangehörigkeit zu betrachten waren (Art. 3 der Verfassung). So war beispielsweise ein Hamburger Bürger einem preußischen Bürger gleichgestellt, blieb aber Hamburger Bürger, sofern er sich nicht entschloss, die preußische Staatsangehörigkeit anzunehmen. Deren Erwerb war unter der Voraussetzung, dass er für sich selber sorgen konnte, allerdings relativ problemlos möglich. Im Übrigen galt das formal gesehen auch für Nicht-Deutsche; die Kenntnis deutscher Sprache und Kultur wurde von Einwanderern nicht gefordert, lediglich die Fähigkeit zur Selbstversorgung und Unbescholtenheit. Das schloss freilich Diskriminierungen aus politischen, ethnischen oder religiösen Gründen nicht aus. Eine reichsunmittelbare Staatsangehörigkeit, die nicht unmittelbar an einen Wohnsitz in einem der Bundesstaaten geknüpft war, wurde erst mit der Novellierung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes 1913 eingeführt. Staatsangehörigkeiten stellen einen besonderen Fall von Vernetzung dar und sind zunächst ›nur‹ eine Einbindung in einen übergeordneten rechtlichen Raum, der einerseits durch international anerkannte Staatsgrenzen und andererseits durch Zugehörigkeit definiert ist.
Читать дальше