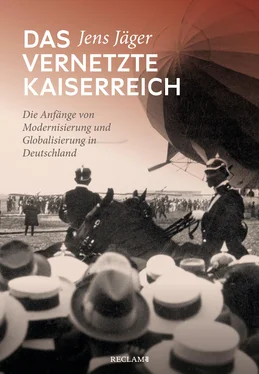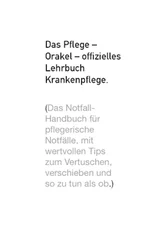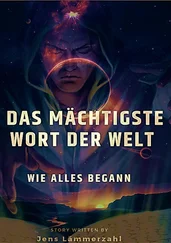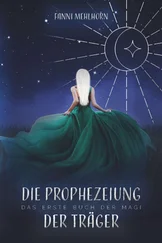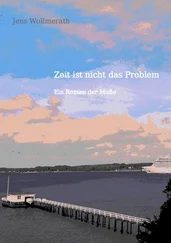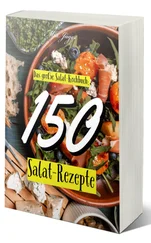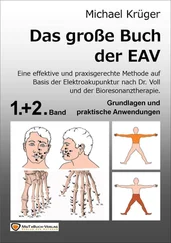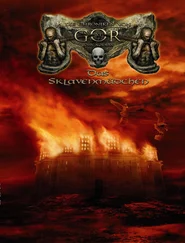Die Zeitgenossen im Kaiserreich dachten selbst darüber nach, wie sehr sich ihre Welt veränderte. Sie waren überzeugt, »dass sie modern seien oder dass sie in einer modernen Welt lebten, ob sie das mochten oder nicht«, wie es Christopher A. Bayly ausgedrückt hat.4 Diese Selbstreflexion begleitete die Entwicklungen. Tatsächlich wurden im Kaiserreich die Worte ›modern‹ und ›Moderne‹ im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts immer häufiger verwendet. Die Konjunktur der Worte in gedruckten Texten lässt sich statistisch auswerten, und das verweist auf einen wichtigen Aspekt von Modernisierung: Printmedien wurden immer alltäglicher, und das hatte weitreichende Konsequenzen. Das gedruckte Wort erreicht nicht nur sehr viel mehr Menschen, es verbindet die Menschen auch untereinander.
Eine Voraussetzung jeglicher Modernisierungsprozesse, nicht zuletzt natürlich für die oben erwähnte Selbstreflexion, war die zunehmende Vernetzung der Gesellschaft durch bessere Kommunikationsmöglichkeiten. Nicht nur der Gedankenaustausch zwischen Individuen durch die Post, Telegraph und Telefon, sondern auch der Kontakt zwischen allen möglichen Druckerzeugnissen, vom Kalender über die Zeitung bis hin zur Enzyklopädie, und ihrer Leserschaft intensivierte sich. Gleichzeitig vervielfältigten sich die Möglichkeiten, Menschen und Dinge über weite Entfernungen zuverlässig und regelmäßig zu transportieren. Beides zusammen brachte Menschen, Güter und Ideen in bis dato unerhörtem Maß in Bewegung, es beschleunigte und intensivierte alle Austauschprozesse. Tatsächlich dürfte die außerordentliche Erweiterung direkter und indirekter (realer wie virtueller) Kontakte ein grundsätzlicher Baustein jeglicher Modernisierung sein. Zunehmende Vernetzung, ob nun gewollt oder nicht, war das Schicksal jedes Einzelnen.
In der Forschung zum Kaiserreich ist dies auch immer wahrgenommen worden. Allerdings haben sich die Geschichtswissenschaften vor allem für drei Ebenen interessiert: die wirtschaftliche, die soziokulturelle und die politische. Noch dazu wurden diese lange Zeit, teils ausschließlich, bezüglich ihrer Bedeutung für die »innere Nationsbildung« (Hans-Peter Ullmann) betrachtet. Die zunehmende Verflechtung von Wirtschaft, Kultur, sozialen Beziehungen und Politik über Ländergrenzen hinweg wurde zwar bemerkt, aber im Vergleich mit den Entwicklungen innerhalb des Kaiserreichs weniger beachtet.
Seit die Geschichtswissenschaft sich transnationalen und globalhistorischen Ansätzen geöffnet hat, hat sich ihr Fokus nachhaltig verschoben. Nun wird das Verhältnis zwischen Prozessen der Globalisierung, also der Vernetzung weit über die politischen Grenzen eines Staates hinaus, und der Nationalisierung neu untersucht, immer wieder mit Verweis auf die Bedeutung der sich rasch ändernden Verkehrs- und Kommunikationssysteme. Johannes Paulmann hat den Begriff einer »Kommunikations- und Verkehrsrevolution« geprägt, deren Konsequenzen für alle gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereiche er hervorhebt.
Bislang weniger untersucht ist, wie sich die Vernetzung auf lokale und regionale Verhältnisse auswirkte, die sich ja ebenfalls neu ausrichteten. Überhaupt spricht vieles dafür, dass die lokal organisierte Heimatbewegung gerade deswegen Zulauf erhielt, weil die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Dynamik den Blick für die Verhältnisse vor Ort schärfte. Nicht nur die Honoratioren in Kleinstädten und Dörfern stellten sich nun die Frage, wer man war und sein wollte. Es ging um nichts weniger als die Neubestimmung der eigenen Identität angesichts von Nationalisierung und Globalisierung. Obwohl ihre politisch-ideologische Ausrichtung oftmals traditionalistisch-konservativ mit einem Hang zum Chauvinistisch-Völkischen war, sind die Heimatbewegungen auch moderne Erscheinungen gewesen. Sie organisierten sich zeitgemäß und hatten Entwicklungen außerhalb Deutschlands im Blick.
Das Deutsche Kaiserreich war also eine Gesellschaft, die sich immer weiter verknüpfte, d. h. Beziehungen über immer weitere Entfernungen pflegte und intensivierte. Das fand auf mehreren Ebenen statt: erstens einer individuell geprägten, die persönliche Beziehungen betraf; zweitens einer kollektiven, in der Massenmedien eine entscheidende Rolle spielten, drittens einer administrativen, in Gestalt neuer Rechtsnormen und Standardisierungen (etwa von Zeit und Maßeinheiten), sowie viertens einer dinglichen, die infrastrukturelle Maßnahmen beinhaltete – wozu der Anschluss an Verkehrs- und Kommunikationsnetze ebenso gehörte wie die Anbindung an Ver- und Entsorgungsnetze. Kurz: »alles Stabile, das notwendig ist, um Mobilität und einen Austausch von Menschen, Gütern und Ideen zu ermöglichen«, wie es der Historiker Dirk van Laak ausdrückt.5
Diese vier Ebenen überschnitten einander, und insbesondere die »dinglich« genannte Vernetzung ist ohne administrative Begleitung kaum vorstellbar. Besagte Ebenen werde ich kurz aufzählen, um die Vielfalt der Verknüpfungen aufzuzeigen, die im Kaiserreich mehr oder weniger alle Menschen betrafen.
Eine besondere Form der Verflechtung ist die Nationsbildung in einem Staatsgebiet. Das ist eine zugegebenermaßen etwas eigentümliche Art, einen Nationalstaat zu bezeichnen, der von seinen Verfechtern ja als natürliche Gemeinschaft definiert wurde. Aber schließlich war das Kaiserreich nicht von selbst oder gar folgerichtig in der Form entstanden, in der es im Januar 1871 proklamiert wurde. Das Deutsche Kaiserreich legitimierte sich laut seiner Verfassung als »ewiger Bund« souveräner Staaten. Es war in keiner Weise natürlich zusammengewachsen, und tatsächlich hatten deutsche Staaten nur fünf Jahre zuvor, 1866, einander im preußisch-österreichischen Krieg noch feindlich gegenübergestanden. Thomas Nipperdeys oft gescholtener Satz »Am Anfang war Bismarck« verweist darauf, welche entscheidende Rolle der politischen Elite bei der Staatsgründung zukam. Zwar basierte das Kaiserreich auf bereits vorhandenen Strukturen (darunter Zollverein und Norddeutscher Bund) sowie einer zumeist bürgerlich geprägten Nationalbewegung, deren eigenes Modell eines Nationalstaats jedoch 1848/49 gescheitert war. Der Staat von 1871 war aber eben auch einer eher zufälligen politischen Konstellation geschuldet, die sich aus einer relativen Schwäche Österreich-Ungarns, dem gewonnenen Krieg gegen Frankreich und dem Wohlwollen Großbritanniens und Russlands zusammensetzte.
Der Schweizer Kulturhistoriker Jacob Burckhardt (1818–1897) war nicht der Einzige, der diesen Akt als Ergebnis sowohl des Zufalls als auch des politischen Willens der herrschenden Elite sah. Mit Blick auf die Geschichtsschreibung zu Deutschland schrieb er 1872 an seinen Freund, den in Bruchsal lebenden Stadtdirektor Friedrich von Preen (1823–1898), dass es wohl nicht allzu lange dauern würde, bis »die ganze Weltgeschichte von Adam an siegesdeutsch angestrichen und auf 1870/71 orientiert« werden würde.6 Damit hob er hervor, wie viel speziell die Geschichtswissenschaft zur spezifischen nationalen Bewusstseinsbildung beitrug, und machte den konstruierten Charakter des deutschen Staatswesens von 1871 deutlich. Tatsächlich haben Historiker nach 1871 die Geschichte oft vom Standpunkt der Reichsgründung aus neu betrachtet und versucht, im Nachhinein eine zielgerichtete Entwicklung dorthin zu begründen. Auch wurde die deutsche Nation zunehmend mit dem Kaiserreich gleichgesetzt, obwohl anerkannt wurde, dass es auch zahlreiche Deutsche außerhalb seiner Grenzen gab. Das Bekenntnis zum Kaiserreich stabilisierte die bestehenden Herrschaftsverhältnisse. Dieses Bekenntnis fußte aber nicht allein auf der Deutung der Geschichte, sondern bedurfte der An- und Einbindung der Menschen an und in den Staat. Und schon haben wir es wieder mit einem Prozess der Verflechtung und Vernetzung zu tun.
Die nationalstaatliche Gemeinschaft wurde zeitgenössisch durch sprachliche und kulturelle, zunehmend auch ethnische sowie historische Gemeinsamkeiten definiert, die sich idealerweise in einem politischen Gebilde als Staat ausdrückten; nur musste dies aktiv so kommuniziert werden und zumindest ansatzweise auch im Alltag spürbar sein, damit die Nation zusammenwuchs. Der Staat wurde zumeist als eine geschlossene geographische Einheit gedacht, die durch klare Grenzen definiert war. Insbesondere seit dem 19. Jahrhundert begriff man die Übereinstimmung von »Nation« und »Staat« als erstrebenswerte politische Ordnung, die gleichwohl überaus vielfältige Formen angenommen hatte. Eine Nation zu sein oder werden zu wollen kennzeichnete multi-ethnische Imperien ebenso wie kleine bis winzige Staaten.
Читать дальше