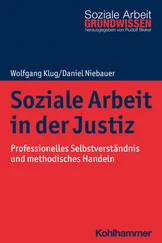Die Soziale Arbeit bringt darüber hinaus eine kritische Reflexivität in Hinblick auf normative Zuschreibungen ein und sucht hier grundsätzlich die Spielräume von Normalität zu erweitern, statt diese zu verkürzen. Die oben angesprochene weit verbreitete Stigmatisierung von Suchtkranken ist nach wie vor ein großes soziales Hindernis der Krankheitsbewältigung, und eine anwaltschaftliche Vertretung von marginalisierten Gruppen der Gesellschaft – auch in der öffentlichen Wahrnehmung – gehört zum Aufgabenspektrum der Sozialen Arbeit.
Zudem macht sich die Soziale Arbeit stark für einen Umgang mit Erkrankung, der nicht nur auf Heilung zielt, sondern ihre Aufgabe auch darin sieht, Menschen auf dem Kontinuum von Gesundheit und Krankheit zu begleiten und sie in den einzelnen Phasen entsprechend zu beraten und zu unterstützen. Dabei sind der Respekt und die Achtung vor der Autonomie des Menschen – gerade auch im Bereich der Suchterkrankungen – zentral. Dazu gehört auch ein akzeptierender Umgang mit Lebensentwürfen, die gesundheitsbewusstes Handeln nicht zum Maßstab der Dinge erklären, sondern andere Prioritäten setzen. Er bildet sich auch ab in einer Breite der zur Verfügung stehenden Hilfs- und Unterstützungsangebote für suchtkranke Menschen und für ein System der »zieloffenen« Hilfen ( 
Kap. 8
).
Innerhalb der Sozialen Arbeit hat sich seit einigen Jahren die »Klinische Sozialarbeit t« etabliert, die sich als eine Fachsozialarbeit insbesondere in den Feldern des Gesundheitswesens versteht (Pauls 2013: 17). Als eine spezialisierte Form der Sozialen Arbeit zeichnet sich die Klinische Sozialarbeit durch einen deutlichen Problembezug aus; sie sieht ihr Gegenüber als hilfebedürftige Klienten und Klientinnen, zu denen auch Drogen- und Alkoholabhängige zählen (Pauls 2013: 18). Klinische Sozialarbeit ist spezialisiert auf beratende und behandelnde Soziale Arbeit in den Feldern des Sozial- und Gesundheitswesens. Sie betont die subjektive Erfahrung von Krankheit im Gegensatz zur Krankheit als einer objektiv vermessbaren Störung und sieht ihre Aufgaben vor allem in der Krankheitsbewältigung (Ningel 2011: 68). Jedoch wird ebenfalls an dem doppelten Auftrag der Sozialen Arbeit – Hilfe für den Einzelnen und Änderung der Lebensbedingungen – festgehalten (Pauls 2013: 19f). Der Bezug zur Lebenswelt differenziert damit die Klinische Sozialarbeit von der Psychotherapie. Es wird kontrovers diskutiert, ob mit der Etablierung einer Klinischen Sozialarbeit die Disziplin und Profession der Sozialen Arbeit eher geschwächt oder gestärkt wird. Eine Übersicht der diesbezüglichen Argumente findet sich bei Ningel (2011: 80). Die diesbezügliche Diskussion wird in Kapitel 12: Profil und ausgewählte Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit in der Suchthilfe wiederaufgenommen ( 
Kap. 12
).
 Weiterführende Literatur
Weiterführende Literatur
Antonovsky, A., 1987, Unraveling the Mystery of Health: How People Manage Stress and Stay Well, Jossey-Bass, San Francisco.
Bauer, R., 2014, Sucht zwischen Krankheit und Willensschwäche, Francke, Tübingen.
Pauls, H., 2013, Klinische Sozialarbeit: Grundlagen und Methoden psycho-sozialer Behandlung, 3. Auflage, Beltz Juventa, Weinheim.
2 Modelle der Entstehung von Sucht
 Was Sie in diesem Kapitel lernen können
Was Sie in diesem Kapitel lernen können
In diesem Kapitel lernen Sie vier verschiedene Ansätze kennen, die die Entstehung von Substanzkonsum und Suchtentwicklung erklären. Diese Ansätze sind sehr bedeutsam für die Konzeptualisierung von Prävention, Beratung und Begleitung in der Suchtkrankenhilfe. Abschließend werden die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede der vier Ansätze herausgearbeitet.
Zur Erklärung der Entstehung von riskantem Konsum, Missbrauch und Abhängigkeit liegt eine Vielzahl von Modellen unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen vor.
Verschiedene Schulen innerhalb der Psychologie (z. B. lernpsychologische Ansätze, psychoanalytische Ansätze) haben unterschiedliche Theorien zu Konsum und Abhängigkeitsentwicklung vorgelegt. Ebenso die Soziologie, die Suchtentstehung in vielen Ansätzen in den Kontext devianten Verhaltens stellt, aber auch als ein Lifestyle-Phänomen beschreibt (vgl. Laging 2005: 123–152). Auch die Medizin, die Gesundheitswissenschaften und die Wissenschaft Soziale Arbeit haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, durch welche Faktoren Konsum, riskanter Konsum und abhängige Konsumformen entstehen können. Dieses Buch kann es nicht leisten, einen auch nur annähernd vollständigen Überblick über die vorliegenden Theorieansätze und diesbezüglichen Konzepte zu vermitteln. Vielmehr wird hier ein lediglich kleiner Ausschnitt aus den vorliegenden Ansätzen vorgestellt. Die Auswahl wurde unter dem Gesichtspunkt vorgenommen, dass diejenigen Theorien hier dargestellt und ausführlicher besprochen werden sollen, die in der Prävention, in der Beratung und Begleitung von abhängigen Menschen eine relevante Rolle spielen bzw. auf die sich innerhalb dieser Arbeitsfelder vornehmlich bezogen wird.
2.2 Das Konzept der Risiko- und Schutzfaktoren und multifaktorielle Ansätze
Das Konzept der Risiko- und Schutzfaktoren entstammt der Epidemiologie als einem Zweig der Gesundheitswissenschaft. Die Epidemiologie untersucht den Zusammenhang von Risikofaktoren (Expositionen) und Gesundheitsproblemen (Outcomes) in der Bevölkerung (Razum et al. 2016: 275). Ein Risikofaktor ist demnach ein Merkmal einer Person oder ihrer Umgebung, das das Auftreten einer Erkrankung wahrscheinlicher werden lässt. Risikofaktoren werden in epidemiologischen Studien bestimmt, in denen z. B. festgestellt wird, dass Kinder aus suchtbelasteten Familien häufiger eine Suchtstörung entwickeln als Kinder aus unbelasteten Elternhäusern. Die zentrale Frage der Pathogenese (Krankheitsentstehung) lautet dementsprechend: »Was sind die Risikofaktoren für eine Suchterkrankung?«
Eine ebenfalls große Rolle bei der Erklärung von Suchtentstehung spielt das salutogenetische Konzept bzw. die Salutogenese. Sie basiert auf der Beobachtung, dass es trotz des Vorliegens vieler Risikofaktoren vielen Menschen gelingt, gesund zu bleiben. Die hier relevante Frage ist nicht die, was Menschen krankmacht, sondern, was Menschen trotz Risiken und Belastungen gesund erhält. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine Stärkung der Schutzfaktoren für die Gesundheit wirkungsvoller sein kann als eine Zurückdrängung der Risikofaktoren (Hurrelmann et al. 2016: 677).
In multifaktoriellen Modellen der Suchtentstehung wird das Wissen um die bekannten Risiko- und Schutzfaktoren zusammengetragen und geordnet. Der erste Vorschlag eines solchen multifaktoriellen Modells wurde im Jahr 1973 von Kielholz und Ladewig vorgelegt (Kielholz und Ladewig 1973: 23–36). Die grundlegende Idee lag darin, das damals bekannte Wissen über Risiko- und Schutzfaktoren in eine Systematik der drei Kategorien »Droge«, »Person« und »Umwelt« einzuordnen (Kielholz und Ladewig 1973: 24) ( 
Abb. 1 Abb. 1: Trias der Suchtentwicklung (eigene Darstellung) auf die Entwicklung eines Substanzmissbrauchs wiederholt und belastbar nachgewiesen werden konnte. Bühler und Bühringer (2016: 59) haben auf der Basis dieser Zusammenschau eine Grafik erstellt, die einen Überblick über das zurzeit vorhandene Wissen zu Risiko- und Schutzfaktoren vermittelt und zugleich – im Gegensatz zu der Systematik von Kielholz und Ladewig – die Einflussfaktoren nach Lebenswelten ordnet ( Abb. 2 ). Dabei können Einflussfaktoren spezifisch sein, also ›nur‹ für ein bestimmtes Verhalten gelten (z. B. der Preis der Substanz) oder unspezifisch für mehrere Problemverhaltensweisen bedeutsam sein (z. B. Erziehungsverhalten). Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass einzelne Faktoren unabhängigen Einfluss ausüben. Vielmehr stehen viele der Faktoren miteinander in Beziehung, so hängt z. B. die Stärke des Einflusses der Freundesgruppe auch mit der familiären Situation zusammen. Die Ursachenlage ist immer komplex (Bühler und Bühringer 2016: 58ff). Für die Begründung von Präventionsmaßnahmen hat Abb. 2: Risiko- und Schutzfaktoren des Substanzkonsums (modifiziert nach Bühler und Bühringer 2016: 59) sich das Konzept der Risiko- und Schutzfaktoren als außerordentlich bedeutsam erwiesen: Präventionsmaßnahmen haben das Ziel, den Einfluss der bekannten Risikofaktoren zu vermindern und die Wirkung der Schutzfaktoren zu stärken.
).
Читать дальше
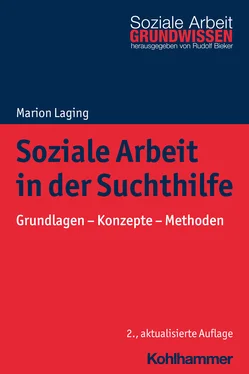

 Weiterführende Literatur
Weiterführende Literatur Was Sie in diesem Kapitel lernen können
Was Sie in diesem Kapitel lernen können