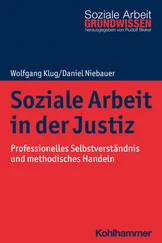Arbeitsfeldstudien zeigen durchgängig, dass die Soziale Arbeit in der Suchthilfe auf einem fachlich hohen Niveau wichtige und eigenständige Beiträge in der Prävention, Begleitung und Bewältigung von Suchterkrankungen erbringt. Trotzdem ist es der Sozialen Arbeit bislang noch nicht vollständig gelungen, sich entsprechend ihrer Bedeutsamkeit kompetent in dem Arbeitsfeld der Suchthilfe zu positionieren und die Rolle einer Kooperationspartnerin auf Augenhöhe mit den anderen im Feld vertretenen Professionen einzunehmen. Vor diesem Hintergrund versteht sich dieses Buch auch als ein Versuch, eine erste – und gewiss noch erweiterbare – Skizze eines eigenständigen transdisziplinären Wissenskorpus für die Soziale Arbeit in der Suchthilfe zu entwerfen. Dieses Buch verfolgt dementsprechend den Ansatz, im Spannungsbogen von Theorie/Empirie und Praxisansätzen diejenigen Wissensbestände zusammenzustellen, die für eine selbstbewusste, wissenschaftsbasierte Praxis der Sozialen Arbeit in der Suchthilfe hilfreich sein können.
Eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus der Kapitel in diesem Band unterbleibt an dieser Stelle. Dieser ergibt sich aus dem Inhaltsverzeichnis und den jeweils einleitenden Worten vor jedem neuen Abschnitt, in dem die zentralen Themen und Diskussionspunkte der jeweiligen Kapitel zusammengefasst werden.
An dieser Stelle möchte ich meinem Partner und Lebensgefährten Anton Ritter meinen Dank aussprechen, der mir immer die Zeit und die Kraft gegeben hat, mich diesem Buchprojekt zu widmen.
| Esslingen, im Juni 2020 |
Marion Laging |
1 Sucht – Eine Erkrankung wie jede andere auch?
 Was Sie in diesem Kapitel lernen können
Was Sie in diesem Kapitel lernen können
In diesem Kapitel lernen Sie die Begriffe »Sucht« und »Abhängigkeit« kennen und es wird Ihnen nahegebracht, welche grundlegenden Vorstellungen sich mit den Begriffen verbinden. Sie erfahren, welche Implikationen in Hinblick auf Verantwortung, Schuld und Selbstbestimmung mit unterschiedlichen Suchtmodellen assoziiert sind und welche allgemeineren Modelle von Krankheit und Gesundheit dahinterstehen. Abschließend werden Ihnen das Selbstverständnis und die Aufgaben der Sozialen Arbeit und der Klinischen Sozialarbeit innerhalb dieser Diskurse kurz vorgestellt.
Jeder Betrachtung von Gesundheit und Krankheit liegt ein bestimmtes Menschenbild zugrunde. Menschenbilder implizieren Vorstellungen darüber, wie Menschen krank werden, wie sie wieder gesunden können und welche Anteile sie am Krankheits- und Genesungsprozess tragen. Diese Vorstellungen können explizit oder implizit sein, bewusst oder unbewusst, rational oder irrational. Sie berühren auch immer ethisch-normative Fragen: Sind wir verpflichtet, im Falle einer Erkrankung alles für eine Genesung zu tun? Was ist kranken Menschen zumutbar, was kann man ihnen abverlangen und an welchen Stellen und in welchem Ausmaß sollte die Solidargemeinschaft eintreten? Sucht als eine »Krankheit des Willens« steht in der Mitte solcher Auseinandersetzungen.
Sucht wurde in Deutschland im Jahr 1968 durch ein Urteil des Bundessozialgerichts als Krankheit mit allen sozialleistungsrechtlichen Folgen und Ansprüchen anerkannt. Trotzdem handelt es sich bei der Sucht für viele Menschen nicht um eine »Krankheit wie jede andere auch«. Sie stellt sich dar als ein schillerndes, herausforderndes Geschehen, das immer wieder durch Medien verschiedenster Art aufgegriffen und inszeniert wird und sich zudem offenbar für Projektionen jeder Art denkbar gut eignet.
In diesem Kapitel soll eine Annäherung an die verschiedenen Sichtweisen, Verständnisse von Sucht vorgenommen werden. Nach einer Auseinandersetzung um die Begriffe Sucht und Abhängigkeit bewegt sich die Auseinandersetzung um die Frage, inwieweit Sucht tatsächlich als eine Erkrankung wie jede andere auch zu verstehen ist und – falls es so sein sollte – welches Modell von Krankheit und Gesundheit dann sinnvoll angewendet werden kann.
1.2 Begriffliche Annäherung
Das Wort »Sucht« (germ. suhti-, ahd. suht, suft, mhd. suht) geht etymologisch auf »siechen« (ahd. siuchan, mhd. siechen) zurück, das Leiden an einer Krankheit. Diese Bedeutung findet sich noch heute in vielen Krankheitsbezeichnungen wieder, wie z. B. der Gelbsucht, Schwindsucht oder Wassersucht. Mit dem Begriff »suchen« ist das Wort Sucht nicht verwandt, obgleich eine Suchtdynamik häufig als erfolglose Suche nach Sinn, nach extremen Erlebnissen, Zuständen oder ähnlichem charakterisiert wird.
In der Alltagssprache hat der Suchtbegriff einen festen Platz erhalten. Sowohl die Abhängigkeit von Substanzen als auch ein als zwanghaft erlebtes Verhalten wird oftmals als »süchtig« bezeichnet. »Süchtig nach Dir«, »Süchtig nach Schokolade« oder ähnliche Redewendungen beschreiben ein zwanghaftes Sich-Hingezogen-Fühlen zu Gegenständen, Personen oder auch Verhaltensweisen.
Begriffe wie »Geltungssucht«, »Tobsucht« beziehen sich eher auf Persönlichkeitsmerkmale von Menschen. In ihnen klingt aber ebenfalls das Merkmal der Übertreibung an und die mangelnde Fähigkeit oder ein Unwille, diese »übertriebenen« Eigenschaften in gemäßigtere Bahnen zu lenken.
In der Fachwelt wurde und wird der Begriff »Sucht« auch kritisch diskutiert: Der Begriff »Sucht« sei äußerst negativ besetzt und würde die Diskriminierung und Marginalisierung von Betroffenen vorantreiben, Stigmatisierungsprozesse verstärken und einen offenen und unvoreingenommenen Umgang mit dem Problem eher verhindern. Vor dem Hintergrund dieser Argumente hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die das diagnostische Manual der International Classification of Diseases (ICD-10, 
Kap. 11
) herausgibt, im Jahr 1963 den Begriff »Sucht« (addiction) durch den Begriff der »Abhängigkeit« (dependence) bzw. durch das »Abhängigkeitssyndrom« ersetzt.
Doch auch der Abhängigkeitsbegriff erfuhr Kritik: Er verallgemeinere zu stark und verharmlose das Krankheitsgeschehen. Eine Abhängigkeitserkrankung im Sinne des ICD-10 sei beispielsweise mit der Abhängigkeit des Kleinkindes von seinen Bezugspersonen in keiner Weise vergleichbar und würde dem Leid, das oftmals mit einer Abhängigkeitserkrankung verbunden ist, nicht gerecht werden.
So hat sich in der Fachwelt die durch die WHO vorgenommene Umbenennung von »Sucht« nach »Abhängigkeit« nicht vollständig durchsetzen können: Die größte deutsche Fachzeitschrift heißt »Sucht«, eine der bedeutsamsten internationalen Fachzeitschriften »addiction«, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung gibt jährlich einen »Sucht- und Drogenbericht« heraus und die »Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen« vertritt mit wenigen Ausnahmen sämtliche Träger der ambulanten Beratung und Behandlung, der stationären Versorgung und der Selbsthilfe. Die Beratung abhängiger Menschen findet in der Regel in »Suchtberatungsstellen« statt.
Heute findet sich dementsprechend meist ein synonymer Gebrauch der Begriffe »Sucht« und »Abhängigkeit«, dem auch in diesem Buch gefolgt wird. Wenn jedoch der Begriff »Sucht« manchmal zu überwiegen scheint, so ist dies dem Umstand geschuldet, dass sich manche Konstrukte nicht durch den Abhängigkeitsbegriff ausdrücken lassen: Es gibt ein Suchthilfesystem in Deutschland, aber kein Abhängigkeitshilfesystem.
Konsequenter ist die Umstellung des Begriffs »Rauschgift« gelungen: Dieser wurde in den vergangenen Jahren und vor dem Hintergrund der o. g. Argumente durch die wertneutraleren Begriffe »Substanzen«, »psychoaktive Substanzen« oder »psychotrope Substanzen« fast durchgängig ersetzt.
Читать дальше
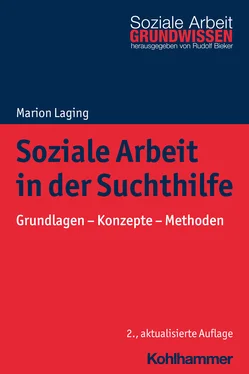
 Was Sie in diesem Kapitel lernen können
Was Sie in diesem Kapitel lernen können