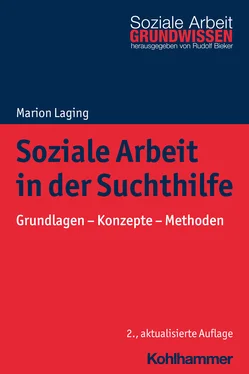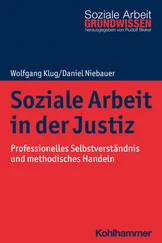1.3 Substanzgebundene und substanzungebundene Süchte
Grundsätzlich kann zwischen substanzgebundenen und substanzungebundenen Süchten unterschieden werden. Substanzgebundene oder auch stoffgebundene Süchte sind immer mit dem Konsum psychoaktiver Substanzen verbunden; demgegenüber steht bei den substanzungebundenen bzw. stoffungebundenen Süchten ein bestimmtes Verhalten im Zentrum des Suchtgeschehens.
Die WHO geht davon aus, dass das Abhängigkeitssyndrom als Krankheit nur dann zu diagnostizieren ist, wenn dies mit einem Substanzkonsum verbunden ist. Im Kontext des Konsums folgender Substanzen bzw. Substanzgruppen kann laut WHO eine Abhängigkeit entstehen: Alkohol, Opioide, Cannabinoide, Sedativa und Hypnotika, Kokain, weitere Stimulanzien einschließlich Koffein, Halluzinogene, Tabak, flüchtige Lösungsmittel, andere psychotrope Substanzen (Dilling et al. 2015: 46). Damit sind legale Substanzen (z. B. Tabak), illegale Substanzen (z. B. Cannabinoide) und bestimmte Medikamente (z. B. Sedativa) gleichermaßen im ICD-10 aufgenommen, ohne dass der ICD-10 in Hinblick auf den rechtlichen Status einer Substanz eine Unterscheidung vornimmt. In der Tat gibt es hier auch zahlreiche Überschneidungen: Opioide können beispielsweise sowohl als illegales »Straßenheroin« als auch legal in Form von bestimmten Medikamenten konsumiert werden und dabei gleichermaßen Abhängigkeitserkrankungen auslösen.
Das ebenfalls bedeutsame Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen hat in seiner fünften Revision (DSM-5, Falkai und Wittchen, 2015) demgegenüber die Glücksspielsucht als erste stoffungebundene Sucht in die Gruppe der Abhängigkeitserkrankungen mit aufgenommen.
Andere zwanghafte Verhaltensweisen, wie sie z. B. mit den Begriffen Sexsucht und Kaufsucht ebenfalls als Abhängigkeitserkrankung diskutiert werden, gehören aus der Perspektive von ICD-10 und DSM-5 nicht in die Gruppe der Abhängigkeitserkrankungen. Andere Autoren verweisen darauf, dass nicht der Substanzkonsum im Zentrum einer Abhängigkeitsentwicklung steht, sondern dass vor allem die dahinterstehende Psycho-Dynamik relevant sei ( 
Kap. 2 2 Modelle der Entstehung von Sucht Was Sie in diesem Kapitel lernen können In diesem Kapitel lernen Sie vier verschiedene Ansätze kennen, die die Entstehung von Substanzkonsum und Suchtentwicklung erklären. Diese Ansätze sind sehr bedeutsam für die Konzeptualisierung von Prävention, Beratung und Begleitung in der Suchtkrankenhilfe. Abschließend werden die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede der vier Ansätze herausgearbeitet.
) und dass diese bei den substanzungebundenen wie bei den substanzgebundenen Süchten durchaus vergleichbar sei. Sie plädieren dementsprechend dafür, auch die substanzungebundenen Süchte als Süchte zu betrachten.
In diesem Buch wird in den nachfolgenden Darstellungen der Fokus auf die Substanzen und Suchtformen gelegt, die aus der Perspektive der Praxis der Suchtkrankenhilfe relevant sind.
1.4 Sucht als ein Phänomen der Moderne
Dem übermäßigen Konsum von psychoaktiven Substanzen einen »Krankheitswert« zuzuordnen, ist ein Phänomen der Moderne. Auch wenn es in vormodernen Zeiten übermäßigen und schädlichen Substanzkonsum gegeben hat (z. B. die legendären mittelalterlichen Trinkgelage), so ist eine Verknüpfung von einem bestimmten Konsumverhalten mit einer Krankheitszuschreibung eine neuzeitliche Idee, weswegen auch von der »Erfindung der Sucht « gesprochen wird (Groenemeyer und Laging 2012). Die »Erfindung« der Sucht fand in einem gesellschaftlichen Zusammenhang statt, in dem die gesellschaftlichen Anforderungen an den Menschen in Bezug auf Rationalität und Selbstkontrolle sehr viel stärker wurden. Damit wurde Trunkenheit erstmals als ein Mangel an Selbstdisziplin und als Verlust von Selbstkontrolle erfahrbar. Benjamin Rush (1745–1813) war der erste, der übermäßigen Alkoholkonsumformen einen Krankheitswert zugewiesen hat. Seine Krankheitskonzeption nahm bereits zentrale Merkmale vorweg, die 175 Jahre später mit den Arbeiten von Elvin Morton Jellinek (1890–1963) allgemeine Anerkennung erlangten ( 
Kap. 3 3 Psychotrope Substanzen Was Sie in diesem Kapitel lernen können In diesem Abschnitt erhalten Sie grundlegende Informationen zu den wichtigsten psychotropen Substanzen, die in Deutschland konsumiert werden können, sowie ihren erwünschten und unerwünschten Wirkungen. Sie erhalten darüber hinaus einen Einblick in die historischen und kulturellen Kontexte des jeweiligen Drogengebrauchs, die deutlich machen, dass der Konsum bestimmter Drogen auch immer ein Ausdruck der jeweiligen Lebensauffassungen und Wertvorstellungen einer Gesellschaft ist. Diese Informationen können dazu beitragen, Drogenkonsumenten und -konsumentinnen und ihre Situation besser zu verstehen und sie besser unterstützen zu können.
). Rush ging davon aus, dass der Liebe zum Alkohol zunächst eine willentliche Entscheidung vorausgeht, die über ein gewohnheitsmäßiges Trinken dann allerdings zu einer Notwendigkeit wird. Diesen Zustand bezeichnet Rush dann als eine »Krankheit des Willens«. Aus diesem bereits als Sucht bezeichneten Verlangen nach Alkohol wird von Rush der ökonomische Ruin und der soziale Abstieg der betroffenen Individuen abgeleitet; eine soziale Komponente findet sich dementsprechend von Beginn der Auseinandersetzung an um das Phänomen Sucht (ebenda).
Aber erst im Juni 1968 stellte das Bundessozialgericht in Deutschland fest, dass Sucht als Erkrankung anzuerkennen sei und damit die Krankenkassen und die Rentenversicherungsträger für die Kosten von Behandlung und Rehabilitation einzutreten haben. Doch ungeachtet dessen gibt es weiterhin Thematisierungen auf unterschiedlichen Ebenen (Fachöffentlichkeit, medial, unter Betroffenen, z. B. Anonymen Alkoholikern) zu der Frage, ob und inwieweit Sucht tatsächlich eine Erkrankung ist, die einen Menschen »treffen« kann, wie beispielsweise Rheuma oder Parkinson, oder ob es sich bei der Sucht nicht doch zum großen Teil um eine Art moralisches Fehlverhalten handele. Beide Modelle – Sucht als eine Erkrankung im medizinischen Sinne und Sucht als ein Fehlverhalten – sind aber nicht die einzigen diskutierten Modelle, Vorstellungen bzw. Denkstile zu dem Phänomen Sucht (vgl. Wolf 2003). Sie sollen aber hier herausgestellt werden, da sie in einem engen Bezug zu der Frage stehen, inwieweit ein suchtkranker Mensch für seine Sucht persönlich zur Verantwortung zu ziehen ist und dementsprechend auch, welche Haltung suchtkranken Menschen im Kontext der jeweiligen Modelle zuteilwerden sollte.
1.5 Sucht: Krankheit oder Fehlverhalten?
In einem Aufsatz von Morse (2004) finden sich zusammenfassend die zentralen Argumente der beiden o. g. Perspektiven. Dabei ist wichtig, sich zunächst die Implikationen eines bio-medizinisch geprägten Krankheitsmodells zu vergegenwärtigen.
Der bio-medizinische Blick auf Sucht als Erkrankung hat weitreichende Implikationen: Die Medizin geht im Allgemeinen bei einer Erkrankung von einer zugrundeliegenden Störung und darauf bezogenen Symptomen aus, so wie beispielsweise eine Grippeinfektion die Symptome Schnupfen, Husten und Fieber hervorbringt. Zudem wird davon ausgegangen, dass der Erkrankte weder für die zugrundeliegende Störung noch für die jeweiligen Symptome und Anzeichen verantwortlich ist und dass grundsätzlich Erkrankungen als unwillkommene und unangenehme Zustände von Menschen erlebt werden. Die Anzeichen und Symptome unterliegen nicht der willentlichen Steuerung, sondern sie sind lediglich mechanische, biophysische Effekte bzw. Ausdrucksformen der darunterliegenden Pathologie.
Читать дальше