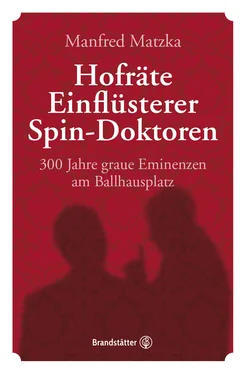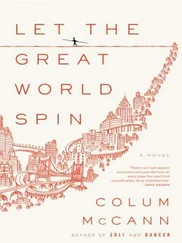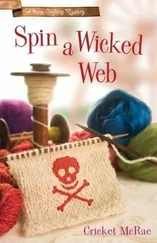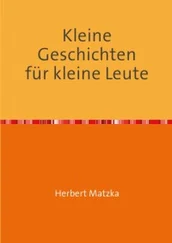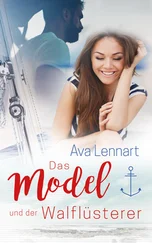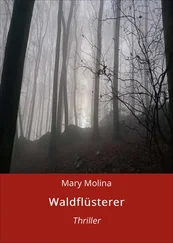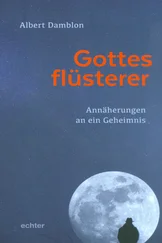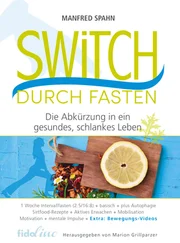Dennoch vertraut die Kaiserin die Erziehung und den Unterricht ihres ältesten Sohnes Joseph dem alten Berater an. Er entwirft die Grundlinien der Ausbildung, definiert die Fächer, die für einen künftigen Regenten wichtig sind, und erstellt umfangreiche Skripten. Am Ende umfassen diese 14 handschriftliche Bände sowie sechs zusätzliche mit Beilagen. Eine darin enthaltene Zusammenstellung soll ein detailliertes Bild des aktuellen inneren Zustandes der einzelnen Länder der österreichischen Monarchie vermitteln – diese „Compendien über den Kaiserstaat und dessen Verwaltung, Nachrichten von den ungarischen und siebenbürgischen Bergwerken, Rechtscompendien“ bleiben allerdings unvollendet.
Einmal ergibt sich noch ein völkerrechtlicher Konsultationsbedarf: Als Maria Theresia nach der verlorenen Schlacht bei Prag im Mai 1757 nahe daran ist, dem preußischen König Friedrich II. einen Teil Böhmens abzutreten, bäumt sich der alte Recke in seiner Funktion als böhmischer Hofvizekanzler dagegen auf: Zitternd legt er die bereits ausformulierte Urkunde aus der Hand und verweigert die Unterschrift. „Wir befehlen es ihm hiermit“, ruft die Kaiserin aus, aber Bartenstein wirft sich ihr förmlich zu Füßen und beschwört sie, von dem Vorhaben abzulassen. Maria Theresia fügt sich schließlich tatsächlich, Feldmarschall Leopold Joseph von Daun erhält Order, Prag zu entsetzen. Wenige Wochen danach entscheidet die Schlacht von Kolin tatsächlich das Schicksal Böhmens zugunsten Österreichs.
Am 5. August 1767 geht Bartensteins Leben zu Ende. Seinen Kindern hinterlässt er ein enormes Vermögen von mehr als anderthalb Millionen Gulden, das er der Freigebigkeit Maria Theresias verdankt. Nicht ohne realen Bezug hat ja die Kaiserin gemeint, „ich werde, so lange ich lebe, an diesen Ihren Personen, Kindern und Kindeskindern erkennen, was Sie mir und dem Staate vor Dienste geleistet; auch verobligire (ich) meine Nachkömmlinge, solche an denen Ihrigen allezeit zu erkennen, so lang sie selbige finden und seyn“. Zu diesem Vermögen gehören umfangreiche Ländereien in Niederösterreich, Mähren und Schlesien. Um Zigtausende Gulden hat er Güter in Iglau (Jihlava), Johannesthal (Janov) und Hennersdorf (Jindřichov) gekauft, 1749 Ebreichsdorf, 1760 Raabs. Aus den Erträgen wird die Herrschaft Poysbrunnerworben und im niederösterreichischen Falkenstein die Familiengruft angelegt. Später kommen Besitzungen in Schrems, Tribuswinkel und in Deutsch-Knönitz (Miroslavské Knínice) hinzu. Der Migrant aus Straßburg, der einst als mittelloser Referendar nach Wien kam, hat seine Stellung offensichtlich nicht nur offiziell und politisch, sondern auch persönlich und ökonomisch bestens genutzt. Private Haushaltung und öffentliche Repräsentanz sind ja in seiner Zeit noch nicht voneinander getrennt, finanzielle Zuwendungen für amtliche Tätigkeiten üblich. Erst viel später wird die strikte Abgrenzung zwischen privater und beruflicher Sphäre Auswirkungen auf die Arbeit und das Leben von Hofräten und Ratgebern haben – und einige, die sich nicht daran hielten, unehrenhaft scheitern lassen.
Johann Christoph von Bartenstein ist die erste große Figur eines Ratgebers, dessen Einfluss auf die Entscheidungen der Monarchen klar und über lange Zeit dokumentiert ist. Seine Wirkung, Bedeutung und Arbeitsweise sind mit späteren Beratern durchaus vergleichbar. Auch seine Karriere – kluger und eloquenter Jurist mit direktem Kontakt zur obersten Ebene, Macht, Erfolge, Neider, erzwungener, dennoch ehrenhafter Rückzug – entspricht diesem Muster. Aber seine Stellung gegenüber der wichtigsten Person, die er berät, ist eine besondere und einmalige. Der bürgerlich geborene Einzelgänger hat keine Hausmacht und verfügt nicht über ein solides Beziehungsnetzwerk. Er ist „nur“ der Favorit des Kaiserhauses, der „wahrhaft zutiefst ergebene Diener (und) letzte Mitkämpfer ihrer heroischen Jahre“, „der einflussreichste Ratgeber“, dem Maria Theresia „das Wohlwollen (…) wegen seiner Ergebenheit und unermüdlichen Arbeit“ erhält, er ist „erster Beamter“, „wichtige Stütze“, „vertrauter Mitarbeiter der Kaiserin“. Diese Epitheta ornantia aus der Literatur werden Johann Christoph von Bartenstein wohl gerecht, am besten hat es die Monarchin aber selbst getroffen: „Muß Ihme die Justiz leisten, daß Ihme allein schuldig die Erhaltung dieser Monarchie; ohne Seiner wäre Alles zu Grunde gegangen.“
2.
Visionär und Lehrmeister
JOSEPH FREIHERR VON SONNENFELS
Berater von Maria Theresia und Joseph II. 1765–1815

Reformen gehen hierzulande meist von oben aus und werden mit prominenten Namen verbunden. Joseph von Sonnenfels beeinflusste 50 Jahre lang solche Reformen, ohne selbst höchste Staatsämter innezuhaben. Er war in erster Linie Professor für politische Wissenschaften und Publizist, daneben niederösterreichischer Regierungsrat, Hofrat der Hofkanzlei, Projektmanager, führendes Mitglied von Kommissionen, wichtiger Streiter für den Rechtsstaat, Reformator der Gesetzesssprache und Lehrer berühmter Verwaltungsmänner. Er war der „Montesquieu Österreichs“ und sein Wort hatte über viele Jahre Gewicht bei einer großen Königin und drei Kaisern, in der Politik des Hauses Habsburg und der Wiener Staatenlenker. Sein Verdienst um die Abschaffung von Folter und Todesstrafe ist legendär.
Er hat – anders als viele andere mächtige Berater und graue Eminenzen – nie zu einer höchsten Position oder zum großen Geld gedrängt. Er war persönlich zwar „voll Anmaßung und Eitelkeit, äußerst fanatisch, spricht zuviel und rühmt sich zuviel“, dennoch ist sein Vermächtnis so glorios wie kaum das eines anderen, in der historischen Darstellung kommt er prominenter vor als andere Persönlichkeiten in vergleichbarer Stellung, als „hellleuchtender Stern aus den Tagen des Übergangs von der Dämmerung zum Lichte, unaufhörlich bestrebt, das seines starren Festhaltens am Alten viel verschrieene Österreich vorwärts zu bringen, Mißbräuche beseitigend, Neuerungen fördernd.“
Weder der Tag seiner Geburt, nicht einmal das Jahr sind präzise feststellbar, er wird 1732 oder 1733 in Nikolsburg (Mikulov) in Mähren geboren, die jüdischen Geburtsbücher beginnen erst 1735. Der Großvater ist Oberrabbiner, sein Vater ein etwas unsteter Hebräischlehrer namens Lipman Perlin, den es in die mährische Kleinstadt verschlagen hat. Der hiesige Fürst Carl von Dietrichstein wird auf ihn aufmerksam und nimmt ihn in seine Dienste auf, zuvor jedoch muss er zum katholischen Glauben konvertieren. 1735 lässt er sich samt seinen Söhnen taufen und nimmt den Namen Alois Wienner an. Die Beziehung der Familie zum Fürsten ist für deren weiteren Weg bedeutsam. Joseph, einer der Söhne des Lehrers, ist sogar sein Patenkind, dem er immer wieder ein paar Groschen schenkt. Im Piaristengymnasium seiner Heimatstadt fällt der Bub als begabter und braver Schüler auf. Mit knapp 14 Jahren jedoch holt ihn sein Vater, der in Wien eine akademische Karriere gemacht hat, in die Reichshauptstadt nach, wo Joseph bereits Vorlesungen der Philosophie besucht.

Joseph Freiherr von Sonnenfels (1732–1817)
Alois Wienner ist mittlerweile Lehrer an der Universität, besitzt ein Haus in der Stadt und wird 1746 mit dem Prädikat „von Sonnenfels“ geadelt. Dann aber schlittert er in finanzielle Probleme, seiner Frau droht wegen unbezahlter Rechnungen sogar der Schuldturm, er muss die Universität verlassen und aufs Land übersiedeln. Josephs Ausbildung bricht ab. Längere Zeit geht er weder zur Arbeit noch zur Schule. Erst mit 17 sieht er ein, dass ihn sein Vater nicht unterstützen kann, und meldet sich unter dem Namen Joseph Wienner als Soldat bei den Deutschmeistern. Mit diesen zieht er in den folgenden fünf Jahren nach Maribor, Klagenfurt, ins Böhmische und nach Ungarn. Da er einer der wenigen Gebildeten in der Truppe ist, avanciert er zum Korporal, bildet sich nebenher weiter, liest viel, lernt Französisch von Deserteuren und Böhmisch von den Mädchen und spricht am Ende neun Sprachen.
Читать дальше