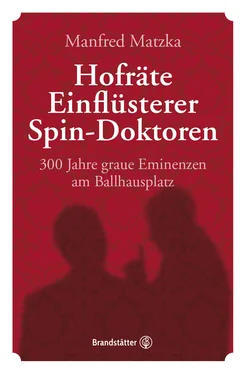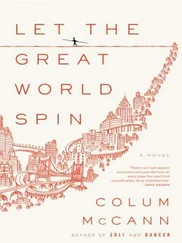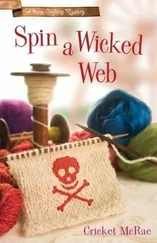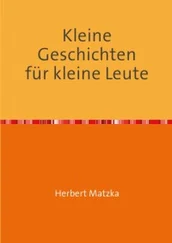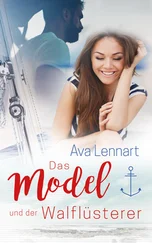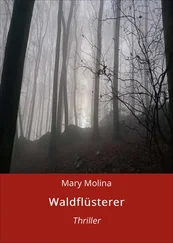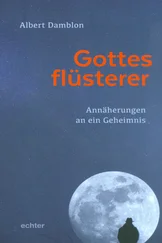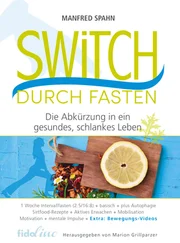Man darf die Ratgeber und ihre Rolle bei all ihrer Bedeutung nicht verklären oder dämonisieren, auch lässt sich kein allgemeines Berufsbild zeichnen. Es gibt nicht „die Beratung“ an sich, keine mit Allgemeingültigkeit darstellbare Beziehung zwischen der grauen und der wirklichen Eminenz. Jede Konstellation ist anders gelagert, jede Beziehung speziell und jeder Anlass entfaltet seine ganz eigene Geschichte. Vor diesem vielfältigen Hintergrund und angesichts unterschiedlicher historischer Epochen lässt sich Beratung und deren Machttechniken nicht abstrakt darstellen. Es bedarf konkreter Personen und Ereignisse, um aus den einzelnen Biografien und historischen Episoden wie bei einem Mosaik ein Gesamtbild entstehen zu lassen. Dabei ist, wie bei jedem Menschen, vor allem die Genese, auch die Herkunft der jeweiligen Persönlichkeit wichtig. So setzen die einzelnen Porträts lange vor jener Zeit ein, bevor die Einflüsterer entscheidende Positionen erreicht haben, und enden, zumindest bei den historischen Figuren, nicht mit ihrem Ausscheiden aus dem Amt – schließlich offenbaren sich erst Jahre und Jahrzehnte später die tatsächlichen Auswirkungen ihres Handelns. Nur so lässt sich verstehen, wie sie in die Macht hineinwuchsen, wann sie entscheidenden Einfluss bekamen und wie lange dieser anhielt.
Trotz der mannigfachen Persönlichkeiten und unterschiedlicher politischer Systeme sind dennoch einige Gemeinsamkeiten erkennbar. Das betrifft die Ausbildung – überwiegend sind sie Juristen – sowie grundlegende Wesenszüge, aus denen sich eine Art Berater-Typologie ableiten lässt: Da gibt es die Visionäre, die weit über den Tag hinausdenken und große Linien und Entwicklungen ins Werk setzen. Oder die braven Staatsdiener, denen das wohlgeordnete Regieren und das allgemeine Wohl oberste Richtschnur ist. Schreibtischtäter sind ebenfalls darunter, die sich keinen Deut darum scheren, was sie mit ihren Entscheidungen anrichten. Ganz im Gegensatz zu den Vertrauten, die den Mächtigen Unterstützung, Sicherheit und Geborgenheit geben. Es gibt die Experten, deren man sich bedient, wenn es gerade nützlich erscheint, und die Netzwerker, die über ausgeklügelte Systeme komplexer Beziehungen steuern und leiten. Schließlich gibt es noch die Wendigen, die sich jedem Herren dienstbar gemacht haben, ganz gleich ob Diktator oder Kanzler.
Von all diesen Beratern handelt dieses Buch.
1.
Der allzeit Getreue
JOHANN CHRISTOPH VON BARTENSTEIN
Berater von Karl VI., Maria Theresia und Joseph II. 1715–1765

An einem feuchtkalten Oktobertag des Jahres 1740 beugt ein würdevoller Einundfünfzigjähriger in der Geheimen Ratsstube der Wiener Hofburg vor Maria Theresia, die gerade ihre Herrschaft antritt, das Knie und bittet den Usancen entsprechend um Enthebung von seinen Hofämtern. Die Königin reagiert kühl und geschäftsmäßig: „Jetzt sei nicht der Augenblick, in welchem er abdanken dürfe. Er solle es sich aber angelegen sein lassen“, fügt sie scharf hinzu, „so viel Gutes zu tun als er vermöge. Böses zu verüben werde sie ihn schon zu hindern wissen.“
Der Mann wird dereinst ihr wichtigster Berater bei der Verwaltung des Habsburgerreichss sein. Der eben verblichene Kaiser Karl VI. hatte bereits eine professionelle Administration samt ihren Hofräten entwickelt – als Staatsdienst, nicht als Hofdienst, und damit grundsätzlich für jedermann zugänglich gemacht. Damit drängte er den Einfluss des Hochadels auf den Staat zurück und eröffnete dem Bürgertum seinen Aufstieg. Es wird bereits auf ein Studium der Rechte an der Universität Wert gelegt. Dafür gibt es eine fixe Besoldung, die insbesondere in den unteren Rängen kärglich ist; dennoch erwartet der Monarch absolute Pflichterfüllung und Hingabe an Beruf und Staat und fordert sie energisch ein. Es ist nicht mehr die Lehensbindung der alten Familien, auf der diese Loyalität beruht, auch ein Amtseid, sogar der eines Zugewanderten, kann dafür Grundlage sein. Eine spezielle Vertrauenswürdigkeit wird allerdings eingefordert: Wenn ein Kandidat jüdisch oder evangelisch ist, hat er bei Amtsantritt zum römisch-katholischen Glauben zu konvertieren – also nach heutigem Verständnis das richtige „Parteibuch“ zu nehmen.
Es bilden sich feste Formen heraus, in denen die Herrscher die Beratung und Unterstützung durch diese Mitarbeiterkaste entgegennehmen. Dazu gehört das Erstellen von Gutachten, insbesondere juristischer Ausarbeitungen zu staatsrechtlichen und völkerrechtlichen Fragen – der Bürokratie kommt da eine zentrale Funktion für die Bildung des Rechtsstaats zu. Ein weiteres Betätigungsfeld sind diplomatische Missionen und Verhandlungen mit konkurrierenden oder verbündeten Mächten. Und nicht zuletzt der persönliche Kontakt, Gespräche in Audienzen, ja sogar die Einbeziehung in wichtige und schwierige innerfamiliäre Entscheidungen.

Johann Christoph Freiherr von Bartenstein (1689–1767)
In dieser Zeit gehen diese hohen Funktionen allmählich vom geheimen Ratskollegium, das im Feudalsystem nur fallweise um den Monarchen versammelt wurde, in ein professionelles Amt über, das permanent Aufgaben für ihn wahrnimmt. Hier arbeiten jetzt die Fürsten-Favoriten und Secretarii, die Hof-Räte in der ursprünglichsten Bedeutung des Wortes. Sie stehen protokollarisch in der zweiten Reihe, werden vom hohen Adel misstrauisch beäugt und bekämpft, üben aber großen Einfluss aus und können in ihrer persönlichen und finanziellen Stellung Privates mit der staatlichen Funktion verbinden.
Eine Persönlichkeit, an der all diese Elemente sichtbar werden, ist jener vor Maria Theresia knieende Mann, den der Kaiser seiner Tochter als persönlichen Ratgeber seines Vertrauens für ihren politischen Weg gewissermaßen hinterlässt: Johann Christoph von Bartenstein, geboren am 23. Oktober1689 in Straßburg und seit 1715 am Wiener Hof.
Er entstammt einer bürgerlichen protestantischen Familie aus Thüringen. Sein Vater Johann Philipp ist Professor der Philosophie und Rektor des Gymnasiums. Er studiert in Straßburg Sprachen, Geschichte, Recht – und das mit besonderem Eifer. Deutsch, Französisch und Latein spricht er Zeit seines Lebens fließend als „Muttersprachen“. Gerade einmal 20 Jahre alt, dissertiert er mit einer rechtshistorischen Schrift. Darin bekräftigt er in streng protestantischer Manier, dass die Reichsstände ihre Waffen gegen den Kaiser ergreifen dürfen. Gleichzeitig stellt er eine enorme Belesenheit und Geschichtskenntnis unter Beweis und erregt mit seiner Arbeit an der Straßburger Universität geradezu Aufsehen.
Der junge Doktor reist danach nach Paris und Wien, um sich – so wie heute junge Juristen in Brüssel und junge Techniker in Deutschland Karrierechancen sondieren – beruflich umzusehen. In Paris trifft er mit den berühmten Benediktinern der Kongregation von Saint-Maur zusammen, die ihm raten, nach Wien zu gehen. Ausgestattet mit einem Empfehlungsschreiben findet er in der Habsburgerresidenz Kontakt zu Gottfried Wilhelm Leibniz. Der Universalgelehrte – und Reichshofrat – empfiehlt ihn für den Eintritt in den Staatsdienst. Dennoch erkundigt sich Bartenstein noch bei anderen Mächten über die Möglichkeit der Aufnahme in die Diplomatie, widerstrebt ihm doch der in Österreich notwendige Übertritt zum Katholizismus.
So wird jahrelang zugewartet, verhandelt und abgewogen. Erst 1715 kommt man zur Vereinbarung, den klugen Elsässer mit dem Titel eines kaiserlichen Rates und tausend Talern Gehalt in den österreichischen Staatsdienst aufzunehmen. Zwei Jahre später wird er zum niederösterreichischen Regierungsrat ernannt, als er 30 Jahre alt ist, wird er in den Ritterstand erhoben. Jetzt kann er sich auch privat etablieren und heiratet 1725 die adelige Maria Doblhoff, die Tochter des kaiserlichen Leibarztes. Bald kommt sein erster Sohn Joseph Philipp zur Welt, neun Jahre später Christoph Innozenz.
Читать дальше