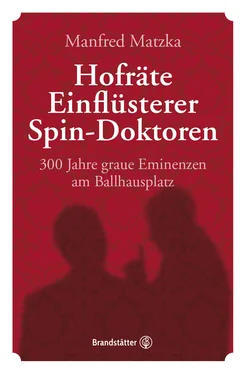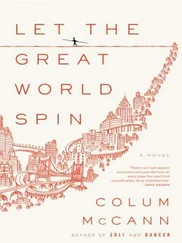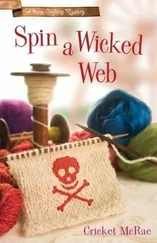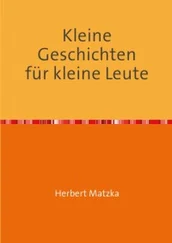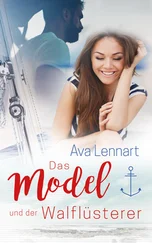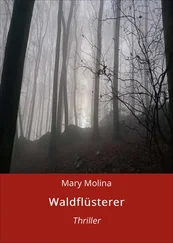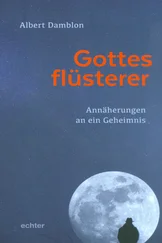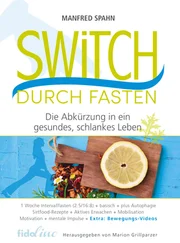Es beginnt die steile Karriere des Freiherrn von Bartenstein. 1726 wird er zum Hofrat bei der österreichischen Hofkanzlei ernannt. Im Jahr darauf geschieht Entscheidendes für seinen Berufsweg. Er wird dem schwer kranken geheimen Staatssekretär Johann Georg von Buol zugeordnet, um für ihn und unter seiner Aufsicht in der Geheimen Konferenz – der Vorläuferorganisation der späteren Ministerräte – das Protokoll zu führen, Beschlüsse vorzubereiten und auszufertigen. Als Buol verstirbt, geht sein Posten auf Bartenstein über. Damit ergibt sich zwangsläufig ein direkter Draht zu Karl VI., der mit seinen Ministern überwiegend schriftlich und somit über Bartenstein verkehrt.

Kaiserin Maria Theresia (1717–1780) und ihr Sohn Joseph
Sein häufiger Kontakt mit dem Monarchen lässt seinen Einfluss von Tag zu Tag wachsen. Ein weiterer Grund ist, dass er als Sekretär der Geheimen Konferenz zwar an deren Beschlüsse und die Vorgaben des Kaisers gebunden ist, doch diese gehen oftmals nicht ins Detail. Für ihn bleibt also ausreichend Raum, hier zu verschärfen, dort zu akzentuieren, da zu interpretieren und etwas wegzulassen oder zu ergänzen. Dabei ist er, wie Zeitzeugen festhalten, „rechthaberisch, aber zugleich überzeugungstreu und von einer Furchtlosigkeit, welche bei einem Niedriggeborenen doppelt überraschte. Nicht nur in der Konferenz, in welcher bloß zu schreiben, nicht aber auch zu sprechen sein Amt wäre, sagt er seine Meinung geradeheraus und verficht sie mit Hartnäckigkeit. Auch gegen die fremden Minister am Wiener Hofe tut er das Gleiche (…), oft in einer Weise, welche wirklich geeignet ist, abzustoßen und zu verletzen.“
Bartenstein festigt mit seinen Kenntnissen, seiner Intelligenz und Wendigkeit die Zuneigung und das unbegrenzte Vertrauen des Monarchen. Vor allem seine wissenschaftliche Qualifikation im deutschen Rechtswesen beeindruckt zutiefst, wobei er sich nicht ungern durch Spitzfindigkeiten und juristische Haarspaltereien, insbesondere in Angelegenheiten des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation hervortut. Diese Lust am Rabulieren und am Advokatischen wird ihm bald eine besondere Aufgabe bescheren.
Karl VI. hat nämlich das große Problem, dass er keinen männlichen Thronerben, sondern nur Töchter hat. Das könnte die Kurfürsten von Bayern und Sachsen, seine Schwäger, dazu verleiten, nach seinem Tod Ansprüche zu stellen und seine Tochter Maria Theresia auszubooten. Zwar hat er bereits 1713 mit der Pragmatischen Sanktiondie weibliche Erbfolge eingeführt. Nun geht es darum, jedes einzelne habsburgische Erbland samt Ungarnzur Annahme dieser verfassungsrechtlichen Verfügung zu bewegen und die Anerkennung durch die internationalen Mächte sicherzustellen.

Kaiser Karl VI. (1685–1740), der Vater von Maria Theresia
Hier erreicht Bartenstein mit diplomatischem Geschick 1723 die Zustimmung Ungarns, 1726 die Brandenburg-Preußens und 1731 die von England. Zwei Jahre später wird er dafür in den Freiherrnstand erhoben, Geheimer Ratund Vizekanzler der Staatskanzlei. In dieser Funktion ist er nach dem Kanzler die Nummer zwei am Ballhausplatz. Mit nur zwei Konzipisten, zwei Kanzlisten und je einem Mann für Versand und Archiv hat er diese Anerkennungen zustande gebracht. Sein Arbeitsstil in der Kanzlei ist eher altmodisch: Er zieht alles an sich, kann nicht delegieren und will auch keinen größeren professionellen Mitarbeiterstab.
Sein Meisterstück für den Kaiser und dessen Älteste ist aber 1735 eine Familienangelegenheit von politischer Tragweite: In den Wiener Verträgen von 1725 hatte sich Karl VI. im Gegenzug für die Anerkennung der Pragmatischen Sanktion verpflichtet, zwei seiner drei Töchter mit dem spanischen Königshaus zu vermählen. Für Maria Theresia hätte dies eine Ehe mit dem Infanten Don Carlosbedeutet – was für die eigenwillige Prinzessin aber ganz und gar nicht in Frage kam. Sie hat sich bereits als Heranwachsende in den um neun Jahre älteren lothringischen Prinzen Franz Stephan verliebt, in dem sie seit ihrem sechsten Lebensjahr den künftigen Ehemann sah.
Bartenstein argumentiert hier zunächst juristisch spitzfindig. Aufgrund des frühen Todes von Maria Theresias Schwester Maria Amalia sei der Vertrag nichtig geworden, weil man nun nicht mehr zwei aus dreien auswählen könne. Dann argumentiert er politisch, dass England und die Niederlande eine Verschiebung des Machtgleichgewichts am Kontinent nicht nur fürchten, sondern die Verbindung zwischen Wien und Madrid auch bekämpfen würden. Gleichzeitig besänftigt er Frankreich, das eine Hochzeit der Erzherzogin mit Franz Stephan von Lothringen zu verhindern sucht. Die mögliche Vereinigung des direkt an der Ostgrenze gelegenen Territoriums mit den Habsburger Ländereien ruft vor allem den französischen Minister Kardinal de Fleury auf den Plan. Bartenstein gewinnt ihn mit der Idee, dass Franz Stephan sein Herzogtumim Tausch gegen die Toskana an Frankreich abtreten werde. Als der Lothringer, der nicht in die Verhandlungen eingebunden war, zögert, macht ihm Bartenstein kurz und bündig klar: „Keine Abtretung, keine Erzherzogin!“
Damit ist die Heirat unter Dach und Fach. Sie findet 1737 in Wien statt, es folgt ein überaus reicher Kindersegen und 1745 wird der Lothringer Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Diese diplomatische Glanzleistung sichert Bartenstein die lebenslange Loyalität Habsburgs. Nebenbei fädelt er auch noch die Ehe der zweiten Kaisertochter Marianne mit dem jüngeren Bruder Franz Stephans ein.
Weniger erfolgreich ist der Berater bei anderen außenpolitischen Analysen und Entscheidungen. Seine Empfehlung, Österreich solle an der Seite Russlandsgegen die Türken1737 in den Krieg eintreten, führt zu einer empfindlichen Niederlage.
Der nobilitierte Bürgersohn ist eine Schlüsselperson am Hof geworden. Sogar altehrwürdige Adelige bemühen sich um seine Gunst und Unterstützung. Gleichzeitig zieht der Emporkömmling aus Straßburg deren Neid und Misstrauen auf sich. In diesen Spannungen ist Bartenstein wenig zimperlich und kein angenehmer Höfling. Wenn ihm besonders Hochgestellte entgegentreten, sorgt er gerne dafür, dass sie den Kürzeren ziehen. Man erzählt, er habe den Bischof von Bamberg, Friedrich Karl Graf Schönborn, um seinen Posten als Reichsvizekanzler gebracht, weil dieser in der geheimen Konferenz zu sagen wagte, das Amt des Sekretärs sei zu schreiben und nicht zu reden. Auch Feldmarschall Joseph Lothar Graf Königsegg musste fast abdanken, nachdem er dem Kaiser riet, „militärische Angelegenheiten lieber seinen Generalen als seinen Schreibern anzuvertrauen“.
Auch in der öffentlichen Meinung ist Bartenstein nicht beliebt. Da er als des Kaisers einflussreichster Ratgeber gilt, wird er für alles verantwortlich gemacht, was unter Karls Regierung schiefläuft – und das ist in seinem letzten Jahrzehnt eher viel. „Die Hauptschuld hievon wurde auf Bartensteins Schultern gewälzt“, schreibt 1871 der Historiker Alfred Ritter von Arneth, „und viele wiesen darauf hin, wie sein Eintritt in jene einflussreiche Stellung so ziemlich mit dem Zeitpunkt zusammenfiel, in welchem der Glücksstern Karls VI. nach und nach zu erbleichen begann. Insbesondere soll er den Kaiser (…) zu all den Opfern verleitet haben, welche gebracht wurden, um sie zur Gewährleistung der Pragmatischen Sanktion zu bewegen, während doch ein Teil dieser Mächte gleich nach des Kaisers Tod dieselbe offen verletzte.“
Als Karl 1740 unerwartet stirbt, wähnen viele Feinde Bartensteins das Ende seiner Macht. Sein Verhältnis zu Thronfolgerin Maria Theresia ist nicht besonders eng, vor allem aber teilt auch sie die Meinung, er trage die Hauptschuld an der unheilvollen Entwicklung der vergangenen Jahre. Doch sieht die junge Königin auch, dass sie einen Routinier als Berater braucht, und Bartenstein stärkt ihr als Einziger am Hof sofort und uneingeschränkt den Rücken. „Alle meine Mitarbeiter ließen, statt mir Mut zuzusprechen, diesen gänzlich sinken, taten sogar, als ob die Lage gar nicht verzweifelt wäre. Ich allein war es, die in allen diesen Drangsalen noch am meisten Mut bewahrte“, schreibt sie in ihrem politischen Testament. Allein Bartenstein, gegen den allseits heftig intrigiert wird, habe sie im Gewirr der Meinungen unterstützt, sie „unvergleichlich souteniret“, und „die Gemüter zu präparieren gewusst“. In dieser Krise und Bedrängnis will und kann die Regentin nicht auf seine Dienste, seine kräftige Stütze, Fähigkeiten und Kenntnisse, seinen festen Charakter und seine unbeugsame Treue zu Habsburg verzichten.
Читать дальше