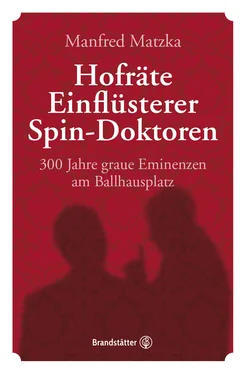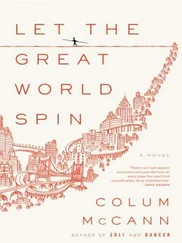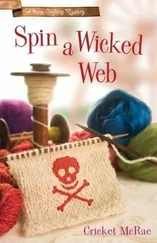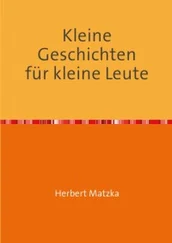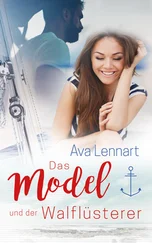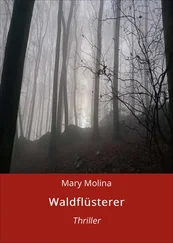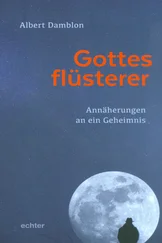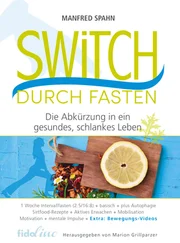Bartenstein nutzt dabei sein Talent, Menschen richtig einzuschätzen. Er enthält sich jeder Schmeichelei, weil er weiß, dass Maria Theresia das durchschaut, und jeder Bevormundung, um sie nicht „durch einen in hofmeisterischem Ton gegebenen Rat zu verletzen, sie ihre Unerfahrenheit fühlen zu lassen. Da er sie allzu geneigt sah, ihrem eigenen Urteil zu misstrauen, trachtet er darnach, sie mit Selbstgefühl zu durchdringen und sie dazu zu bewegen, auch manchmal unbekümmert um ihre Minister Entschlüsse zu fassen und auszuführen.“ In kurzer Zeit wird das und sein unglaublicher Arbeitseinsatz von der Königin anerkannt. Schlau betont er immer wieder, er allein sei es gewesen, der die Heirat mit dem spanischen Infanten verhindert hatte. Gleichzeitig wendet er alle Kraft auf, um die Mitregentschaft Franz Stephans politisch durchzusetzen; und er ist in den schwersten Stunden der Niederlagen gegen Preußen immer zur Stelle.
Ihre ersten Regierungsjahre sind auch die schwierigsten Jahre in Bartensteins politischem Wirken als Ratgeber. Als die habsburgische Monarchie sowohl durch den preußischen Einmarsch in Schlesien als auch infolge der durch Frankreich unterstützten Angriffe Bayerns und Sachsens in eine existenzielle Krise gerät, steht der Freiherr „ungebeugten Sinnes“ zu Monarchie und Monarchin, die er auch darin bestärkt, Gebietsabtretungen strikt abzulehnen und auf der Unteilbarkeit ihrer Länder zu beharren. Er rät dazu, sich Friedrich von Preußen militärisch entgegenzustellen. Er verfasst die Kriegserklärung an Frankreich 1741. Er ist während der Schlesischen Kriegeder wichtigste politische Publizist der Hofburgund vertritt den Rechtsstandpunkt Habsburgs in zahlreichen Druckschriften, die er über die Gesandtschaften in Tausenden Exemplaren verbreiten lässt.
In dieser Zeit wird viel konzipiert, geschrieben, kopiert und expediert in der Staatskanzlei am Ballhausplatz. Bartenstein beklagt erstmals die ständig wachsende Fülle an täglicher Routinearbeit, mit der jedoch keine Personalvermehrung einhergeht. Da er seine Aufgaben lieber im Alleingang erledigt, ist er Tag und Nacht im Hochparterre anzutreffen. Doch die Entscheidungen fallen ab 1740 auf dem Felde: Die schlecht ausgerüsteten, miserabel bezahlten und inkompetent geführten Truppen Österreichs erleiden gegen Preußen eine Niederlage nach der anderen. Bartenstein unterläuft der strategische Fehler, viel zu lange darauf gehofft zu haben, dass Frankreich neutral bleibe. Doch Ludwig XV. tritt bereits nach wenigen Monaten aufseiten Preußens in den Krieg ein. Im Oktober 1741 muss ein schmählicher Waffenstillstand geschlossen werden.
In dieser dramatischen Zeit stirbt auch noch Kanzler Philipp Ludwig Graf Sinzendorf am 8. Februar 1742. Bartenstein macht sich Hoffnungen auf die Nachfolge, hat er doch in den letzten Jahren des Ministers das Außenamt de facto geführt. Die Monarchin aber denkt in Standeskategorien: Nachfolger kann nicht der Bürgersohn Bartenstein werden, sondern nur ein Diplomat von hohem Adelsrang. Als der Freiherr das erkennt, macht er sich auf die Suche nach einer möglichst schwachen Kanzlerpersönlichkeit und findet Anton Corfiz Graf Ulfeldt, den er Maria Theresia erfolgreich präsentiert.
Damit hat er die zweitbeste Lösung für sich erreicht: Er muss sich jetzt zwar formell auf seine Funktion als Sekretär der Geheimen Konferenz stützen, bleibt aber weiterhin die graue Eminenz am Ballhausplatz, da ihm sein Chef, eine matte Figur, großen Gestaltungsraum in der Außenpolitik lässt. Natürlich kränkt es ihn, dass er nicht als Minister ins Palais einziehen kann, sondern in seinem Privathaus in der Bäckerstraße wohnen bleiben muss. Doch er ist Profi und lässt sich das nicht anmerken. Nur im Amtskalender achtet er pedantisch darauf, gleich neben dem Ressortchef genannt zu werden.
Gegenüber den geschniegelten Diplomaten bei Hofe ist der Freiherr weiterhin wenig verbindlich. Daher sind auch deren Urteile über ihn alles andere als schmeichelhaft. Der venezianische Botschafter Foscari beschreibt ihn als „eine eher skurrile Gestalt, ein typischer deutscher Rechtsgelehrter, dem es an jeglicher sozialer Kompetenz fehlt und dessen schriftlicher Ausdruck sich durch einen furchtbaren Stil auszeichnet“. Der Preußische Botschafter Podewil wird sogar untergriffig: Bartenstein sei klein gewachsen „und seine Manieren sind die eines Emporkömmlings. Die Leute von Geburt nachäffend hat er dadurch eine impertinente Haltung angenommen. Er stellt sich als Schönredner hin, bemächtigt sich immer des Gespräches, will überall der Erste sein, schreit wie ein Adler, spielt den Kurzweiligen, behandelt Personen vom vornehmsten Range vertraulich und erlaubt sich gegen sie dasselbe Benehmen wie gegen Seinesgleichen. Mit einem Wort, er ist ein pedantischer Geck.“
Doch Bartenstein erzielt mit dem von ihm gegängelten Minister Ulfeldt außenpolitische Erfolge: England kann zur Intervention gegen Preußen gewonnen werden. Damit wendet sich das Blatt, 1743 kann sich Maria Theresia die böhmische Königskrone aufs Haupt setzen. Noch einmal versuchen die Preußen einen umfassenden Militärschlag, diesmal aber ohne Erfolg. Als 1745 der aus Bayern stammende Kaiser Karl VII. stirbt, schlägt wieder die große Stunde der Diplomaten vom Ballhausplatz: Bartenstein und sein Team schaffen es, Franz Stephan für die Nachfolge als Kaiser in Position zu bringen. Bayern erhält habsburgische Gebiete und unterstützt Franz Stephan. Damit ist auch der Weg zum Frieden mit Preußen frei, der allerdings mit dem Verlust Schlesiens bezahlt werden muss.
Ulfeldt und sein Einflüsterer betreiben eine strikt antifranzösische Politik des Bündnisses mit England und den Niederlanden. Doch es bahnt sich eine neue, für die Zukunft des Freiherrn entscheidende Entwicklung an: Im Jänner 1749 wird der achtunddreißigjährige Wenzel Anton Graf Kaunitz ins Kollegium der Konferenz berufen und steigt rasch zum neuen Vertrauten Maria Theresias in außenpolitischen Fragen auf. Er aber ist frankreichfreundlich.
Kaunitz beginnt, die Geheime Konferenz samt ihrem Sekretär zu entmachten und die auf den Einmannbetrieb des Sechzigjährige zugeschnittene Arbeitspraxis der Kanzlei zu „bürokratisieren“. Es sollen nicht mehr einige wenige Personen dem Chef direkt zuarbeiten, sondern Abteilungen sollen eingerichtet und in diese qualifizierte Beamte eingestellt werden. Außenpolitisch leitet Kaunitz mit seiner profranzösischen Linie einen radikalen Kurswechsel gegenüber der bisherigen Ausrichtung ein, den „Wechsel der Allianzen“. Bartenstein erkennt, dass sein Einfluss sinkt. Er unternimmt noch einige hinhaltende Versuche, um seine Macht zu retten, doch kann er die Entwicklung nur mehr verzögern, nicht mehr verhindern. Nach drei Jahren zäher Intrigen wird er 1753 durch Kaunitzals Leiter der Außenpolitik abgelöst.
Aber die Kaiserin lässt ihren alten Berater und Favoriten nicht ganz fallen. Sie vergoldet ihm den Abschied durch eine Erhöhung seines Gehalts, eine einmalige Zahlung in Höhe von 100.000 Gulden und Stipendien für seine Söhne.
Seine Dienste sind fortan auf die innere Verwaltung der Kronländer beschränkt. Er wird Vizekanzler des Directoriums in publicis et cameralibus – also der österreichisch-böhmischen Hofkanzlei –, zusätzlich wird ihm die Direktion des neu errichteten geheimen Hausarchives übertragen. Zwei Jahre später soll er einen neuen Zolltarif für Österreich ob und unter der Enns erstellen. Später wird er Präsident der illyrischen Hofdeputation, die die Angelegenheiten der aus Serbieneingewanderten Bevölkerung zu regeln hat, und schließlich führt er die Deputation zur Leitung des Sanitätswesens. Das sind zwar nicht bloß Pensionsjobs und Ehren für einen „Senior Expert“, in den zentralen Regierungsprojekten jedoch hat Bartenstein nichts mehr zu sagen. Maria Theresia hat ihren eigenen Weg gefunden, sie hört immer öfter auf eine neue Generation junger, aufgeklärter, kreativer Geister.
Читать дальше