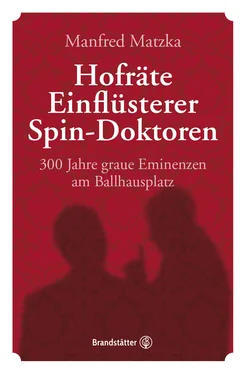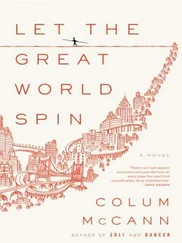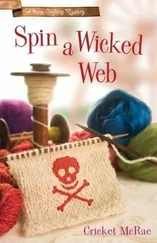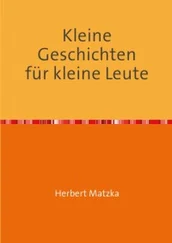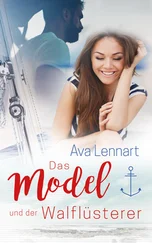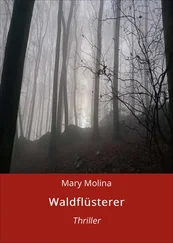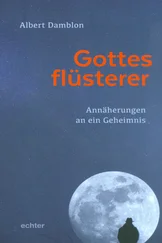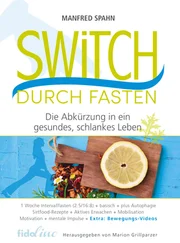Als er erfährt, dass sich die Lage seines Vaters wieder gebessert hat und dieser ihn nun „mit Kost und Wohnung unterstützen“ kann, erwirkt Joseph – über Vermittlung seines Fürsten – seine Entlassung aus dem Militär und beginnt mit 22 Jahren an der Universität Wien Recht zu studieren. Vor allem der reformorientierte Naturrechtler Karl Anton von Martini, der spätere Justizminister Josephs II., beeindruckt ihn. Als Sonnenfels Senior wieder an die Universität zurückkehren kann, arbeitet sein Sohn nach der Promotion zeitweilig als sein Assistent und publiziert einen juristischen Aufsatz. Tatsächlich aber strebt er eine Lehrtätigkeit für Sprachen an, vor allem seiner ausgezeichneten Hebräischkenntnisse wegen. Eine Stelle findet er jedoch nicht.
Der junge Jurist hilft jüdischen Bürgern bei Übersetzungen von Testamenten und Vorschriften, schließlich fängt er in der Hoffnung auf eine spätere besoldete Anstellung als Rechtspraktikant in der „Obersten Justizstelle“ an. Zwei Jahre arbeitet Joseph von Sonnenfels ohne Einkommen, obwohl er bereits aufgrund einiger Publikationen in Insiderkreisen als aufstrebender Wissenschaftler geschätzt wird. Um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, bewirbt er sich schließlich 1761 um die Stelle eines Rechnungsführers und Schreibers bei der kaiserlichen Leibgarde. Sie ist zwar mit 356 Gulden schlecht besoldet, dafür lernt er einen für seinen weiteren Weg wichtigen Mann kennen, General Ernst Gottlieb Freiherr von Petrasch. Dieser erkennt bald, dass der talentierte Achtundzwanzigjährige für den Schreiberposten überqualifiziert ist, und interveniert für eine Dozentur an der Universität. Der junge Mann nutzt die Freundschaft zum Freiherrn, um Zugang zur hochadeligen Wiener Gesellschaft zu erhalten. Einmal darf er sogar ein kleines Theaterstück für die Kaiserkinder schreiben – sein erster direkter Kontakt zum Hof.
Am 2. Jänner 1761 macht der umtriebige Sonnenfels in einer Deutschen Gesellschaft in Wien durch ein brillantes Referat über Sprachkultur von sich reden. Petrasch vermittelt ihm daraufhin einen Kontakt zu Staatsrat Egid Freiherr von Borié, der seit Längerem die Etablierung der Polizei- und Kameralwissenschaften und damit erstmals eine systematische Ausbildung der Beamten an der Universität Wien plant. Mit ihm entwickelt sich eine angeregte Diskussion über Staat, Verwaltung und die Wichtigkeit des Bevölkerungswachstums. Sonnenfels publiziert 1762 mehrere Schriften dazu, die bis zu Kaiserin Maria Theresia gelangen. Sowohl die Monarchin als auch ihr Kanzler Wenzel Graf Kaunitz erkennen die Bedeutung der „Cameralwissenschaft“ als Grundlage für eine Staats- und Verwaltungsreform.

Doppelporträt Kaiserin Maria Theresia und ihr Sohn und Mitregent Kaiser Joseph II. (1741–1790)
Am 17. Mai 1762 hält Sonnenfels eine öffentliche Lobrede auf Maria Theresia anlässlich ihres 45. Geburtstags, die gedruckt und bis Berlin verbreitet wird. Zeitgleich verfasst er ein langes Bewerbungsschreiben für eine Dozentenstelle, in dem er zwar nicht die verlangten Vorlesungspläne darlegt, aber die Kaiserin über seine Quellen informiert: „Die berühmtesten Schriftsteller, deren Werth durchwegs erkannt wird, als: L’esprit de loix, Les Elements du Commerce, La theorie et la practique du Commerce“. Dank seiner beiden hohen Förderer erhält Joseph von Sonnenfels die neu geschaffene Lehrkanzel und wird Professor für Polizei- und Kameralwissenschaften. Die Fakultät wird dabei von der Monarchin glatt übergangen.
Jetzt kann Joseph auch heiraten. Der Ordinarius nimmt die erst fünfzehnjährige Maria Theresia, Tochter eines böhmischen Amtmanns, zur Frau. Sie wird wegen ihrer hohen sozialen Kompetenz und ihres weithin gerühmten Salons große Bedeutung für das gesellschaftliche Netzwerk ihres Gatten erlangen. Die Ehe hält bis zu seinem Tod.
Der Hof setzt sein Gehalt mit nur 500 Gulden jährlich fest, wovon die Familie nicht leben kann, erst über Intervention des Staatsrates Borié werden angemessene 1.200 bewilligt. Als er sich verpflichtet, auch am Theresianum zu unterrichten, werden es sogar 2.000 Gulden. Die Kaiserin nimmt lebhaften Anteil an der Arbeit der Lehrkanzel, sie stiftet Stipendien und will sogar die Namen der Studierenden wissen.
Sonnenfels stürzt sich in die Aufgabe und stellt 1765 ein Lehrbuch fertig, die „Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanz“ in drei Bänden, das Standardwerk für alle Verwaltungsmanager des Kaiserreichs in den nächsten 50 Jahren. Allein dieser Erfolg würde ihm einen bleibenden Platz als Berater sichern, zum Dank ernennt ihn die Kaiserin zum niederösterreichischen Regierungsrat – das ist aber nur ein Titel ohne Aufgaben. Sonnenfels intensiviert seine Arbeit, er verfasst zahlreiche Gutachten für den von Borié geführten Staatsrat – niemand anderer kommt in dessen Akten so häufig vor wie er. Zudem erstellt er Musterbücher mit Eingaben und Erledigungsformularen für den Amtsgebrauch, hält Reden, wo immer es geht, und wird gewissermaßen zum Politologieprofessor der Nation. Als solcher setzt er weitere Lehrstühle nach seinem Muster in Linz, Tyrnau (Trnava) und Klagenfurt durch, erhält zusätzliche Assistenten und baut sich ein Netzwerk auf.
„Sein glänzender Vortrag und die Tüchtigkeit des Inhalts erwarben ihm bald die Liebe und Verehrung der Jugend. In periodischen Blättern trat er gegen alle an dem Baume der Cultur im Laufe der Jahrhunderte sichtbar gewordenen, denselben in seiner Entwicklung störenden Auswüchse auf, gegen den Aberglauben, gegen die Selbstsucht, gegen die schroffen Mängel in der Erziehung, gegen die Vorurtheile des Adels, gegen die Ueberzahl und Zwecklosigkeit der Klöster.“ Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit ist Sonnenfels auch journalistisch tätig, etwa als Herausgeber von „moralischen“ Wochenzeitungen, des Journals „Der Mann ohne Vorurteil“ sowie Publikationen mit blumigen Titeln wie „Der Verkannte“ oder „Theresia und Eleonore“.
In der Folge ist er immer seltener im Hörsaal anzutreffen. Das führt zu einem heftigen Streit mit der Studienhofkommission, die dem heutigen Wissenschaftsministerium entspricht. Doch das ficht Sonnenfels kaum an. Er hat den Staatsrat und die Kaiserin hinter sich. Als ihm 1770 Maria Theresias Sohn und Mitregent Joseph auf Vorschlag der Kommission befiehlt, mehr Vorlesungen zu halten, wendet er sich sofort an die Monarchin, die ihn wieder von der Lehrtätigkeit dispensiert. Er hat es geschafft, vom bloßen Professor zum Direktor der Verwaltungswissenschaften im Land aufzusteigen. Damit ihm künftig niemand in die Quere kommt, lässt er sich selbst in die Studienhofkommission ernennen.
Doch mächtige Feinde intrigieren weiterhin gegen ihn: Einerseits die konservative Hochschule, in deren Gremien es gar nicht gern gesehen wird, dass ein neues Fach mit modernem Zuschnitt ihre wohlgesetzte Ruhe stört und zu neuen Arbeitsweisen und Methoden der Personalrekrutierung im Staat führt. Andererseits die Verwaltungspraktiker, die sich ungern von einem Theoretiker belehren lassen wollen. Und schließlich die Politiker, die den aufklärerischen Elan des Parvenüs missbilligen. Schließlich lehrt er ganz nach dem neuen französischen Geist und wird daher beschuldigt, „das Verständniß für die historischen Grundlagen des Staatswesens und Volkslebens verloren zu haben, und die großartigsten, durch jahrhundertjährige Erfahrung gewonnenen Institutionen und Resultate einseitig den philosophischen Doctrinen der Zeit zu unterstellen“.
Tatsächlich hat Joseph von Sonnenfels die Gabe, moderne Theorien verständlich zu vermitteln und sie für das Reich und dessen Verwaltung nutzbar zu machen. Sein Staatsmodell ist der aufgeklärte Absolutismus, den er als ideale Regierungsform betrachtet. Sinn und Zweck der Gesetze liegen für ihn in der Förderung der allgemeinen Wohlfahrt. Zu große soziale Unterschiede sollen ausgeglichen werden, Herrschaft soll vernunftgeleitet und zweckmäßig agieren, die Regierung verfassungsmäßig handeln. Den Staat teilt er in vier Klassen ein, eine Pyramide mit dem Herrscher an der Spitze.
Читать дальше