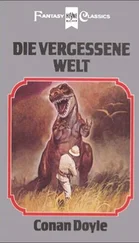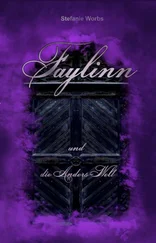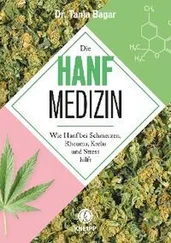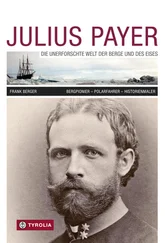Er war ein zärtlicher Liebhaber, ebenso fürsorgend mit ihr wie mit den Kindern, aufmerksam auf ihr Wohl bedacht. Frederic war selbst mit acht Geschwistern als ältester Sohn eines Pastors aufgewachsen, hatte sich immer um die Kleineren kümmern müssen, war trotzdem ein Menschenfreund geblieben. Selbst als der Vater ihn in die Fremde schickte, weil zu wenig Essen da war für alle, folgte er dem Befehl nicht widerstrebend. Er selbst hätte Dijon nie verlassen. Er war vorsichtig, aber ein Optimist. Einmal – er hatte sich gerade das Hemd wieder zugeschnürt – griff er in die Hosentasche und sagte: „Mach die Augen zu.“
„Was kommt jetzt?“, fragte sie.
„Streck die Hand aus.“
Sie erwartete ein Geschenk, ein Armband vielleicht oder Ohrringe. Aber was er in ihre Hand rieseln ließ, war leicht. Kleine Kieselsteine? Selbst dafür war es zu leicht.
Sie öffnete die Augen nicht. „Was ist das?“
„Mach die Augen auf!“
„Getrockneter Kaninchendung?“
Er lachte. „Schwarze Senfkörner. Alles, was mir von meiner Heimat geblieben ist. Wenn ich traurig bin, zermahle ich ein paar davon, lasse mir den Geschmack auf der Zunge zergehen und denke an Dijon.“
„Du brauchst nicht traurig sein“, sagte sie und schloss die Hand zur Faust. „Auch ich musste von zu Hause weg. Aber wir haben es doch gut hier. Besser, als wir es dort jemals hatten.“
Sie küsste ihn. Wie zart er war und wie feinsinnig. Sie wusste, es war ein Risiko, ihn weiterhin zu treffen, aber sie konnte es nicht lassen. Vorerst noch nicht. Im Haus waren sie nicht unbeobachtet. Und der lange Winter würde ihren heimlichen Treffen im Freien sowieso ein Ende setzen. Sie wollte jede Minute mit ihm genießen. Sie steckte ein Korn in den Mund und biss darauf. Es war herbwürzig und scharf.
***
Wilhelm wollte Maria nicht nachspionieren. Er hatte Angst vor dem, was er entdecken könnte. Hans hingegen ertappte er vor der großen Standuhr im Esszimmer: „Emine hat mich gerufen. Wo ist Erich? Was ist da los?“
Hans riss sich von seinem Spiegelbild im Glas der Standuhr los und wollte sich am Vater vorbeiducken, aber der packte ihn am Kragen. Er wusste, dass sich die Kinder gern in der Standuhr verbargen, obwohl er es ihnen mehrfach verboten hatte.
„Emine sagt mir, Erich ist weg. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Es dämmert schon und er ist nicht da.“
„In der Schlucht“, sagte Hans.
„Warum bist du nicht bei ihm?“, fragte Wilhelm. „Du weißt genau, dass du ihn nicht alleinlassen darfst.“
„Er war auf einmal weg“, sagte Hans.
„Wie weg?“, fragte der Vater.
„Ich habe mich umgedreht und er war nicht mehr da.“
„So ein Unsinn! Wo genau wart ihr?“
„Bei Traudl.“
Wilhelm schloss die Augen. Das verdammte Grab. Er war gegen die heimliche Bestattung gewesen. Es war auch gegen den Willen des Herrn. Nicht, dass er besonders religiös war, aber das eigene Kind in einer Höhle in einer entlegenen Schlucht einmauern? Maria hatte ihm keine Wahl gelassen. Nachdem die Kleine am Nikolaustag in ihren Armen verstorben war, hatte Maria das Kind nicht hergegeben. Ihr weiter Lieder vorgesummt und den schon starren Körper gewiegt. Auch Ana hatte sie nicht davon abbringen können. Bei dem Versuch, ihr den Säugling aus dem Arm zu nehmen, hatte sie begonnen so zu schreien, dass er sagte: „Lass es ihr.“
Der nächste christliche Friedhof war in Angora, über zweihundert Meilen entfernt.
„Wir bringen sie in die Schlucht. Dort, wo im Sommer deine Blumen wachsen“, hatte er Maria zugeflüstert. „Da hat sie es schön und du kannst sie immer besuchen. Gib sie mir jetzt.“
Nachdem er diese Sätze viele Male wiederholt hatte, war Maria eingeschlafen.
Wilhelm hätte es nicht übers Herz gebracht, die kleine Leiche am muslimischen Friedhof in Bünyan beisetzen zu lassen, wie Hassan es ihm vorschlug: „Dein Kind ist nicht getauft“, sagte der Schneider. „Der Imam wird nichts dagegen haben. Es kann bei meiner Familie liegen.“
„Ich danke dir“, sagte Wilhelm. „Das ist ein sehr großes Geschenk, das du mir machst. Es ist mir eine große Ehre, dass du dieses Kind zu den Deinen nehmen würdest. Es tut mir leid, dass ich es nicht annehmen kann. In unserem Land besucht man seine Toten. Maria wird ihr Blumen bringen wollen und an ihrem Grab beten. Das ist gegen eure Gebräuche. Es würde zu viel Aufsehen erregen und den Imam beleidigen.“
„Das Kind muss nur mit dem Kopf in Richtung Mekka liegen“, sagte Hassan.
Wilhelm legte seine Hand aufs Herz und berührte dann den Schneider am Arm: „Ich danke dir und werde dein Angebot nie vergessen“, sagte er.
Am nächsten Tag mauerte er Traudl mit eigenen Händen in der Höhle ein. Die Leiche war so klein, sie passte in eine leere Weinkiste. Er hätte einen Sarg für sein Kind zimmern wollen, aber Eile war angebracht. Maria verlangte immer wieder nach dem Kind, wollte seinen Tod nicht zur Kenntnis nehmen. Es war eiskalt und sie war sehr schwach. Wilhelm bettete Mutter und Kind in einem Berg von Decken auf den Schlitten und zog sie in die Schlucht. Dann nahm er ihr den kleinen Körper endgültig aus dem Arm, legte ihn auf das samtene Kissen in der Kiste und nagelte sie zu.
Es war ja nur ein Provisorium, bis sie das Kind in geweihte Erde überführen könnten, dachte er, während er die gebrannten Ziegel auf die Kiste schichtete. Maria war aschfahl, wollte aber unbedingt aufstehen. Sie betete ein Vaterunser und stellte eine Kerze in die Nische. Hier in der Höhle war es windgeschützt, aber die Kerze flackerte. Sie würde bald ausgehen.
„Komm, wir müssen zurück zu Hansi und Erich“, sagte Wilhelm und half Maria auf den Schlitten. Sie gehorchte ihm.
Den Verlust eines weiteren Kindes würde sie nicht überstehen.
Wilhelm öffnete die Augen. „Erich“, sagte er und schüttelte Hans an beiden Schultern, „wo ist er? Habt ihr gestritten? Sag es mir! Wir müssen sofort los!“
Er packte Hans am Arm und zog ihn hinunter in die Küche. Dort stand Hassan und redete auf seine Frau ein, die konzentriert die Fladen in einer Pfanne auf dem offenen Herdfeuer buk.
„Schnell, hol die Fackeln“, sagte Wilhelm zu Hassan. „Wir müssen in die Schlucht. Erich ist weg. Sag auch Omar Bescheid.“
„Wie lange ist es her, dass du ihn alleingelassen hast?“, fragte Wilhelm Hans.
„Es war noch hell und ich habe ihn nicht alleingelassen“, sagte Hans.
„Lüg nicht!“, schrie Wilhelm. „Wenn man einmal einen Hund braucht, ist keiner da.“
Hans begann zu weinen.
„Jetzt erzähl mir einmal, was los war“, sagte Wilhelm nun wieder sanfter, „aber im Gehen, wir dürfen keine Zeit verlieren.“
Er hieß Hassan zum Waffenschrank in die Kammer gehen und die Flinte holen. Die Wölfe kamen im Frühling für gewöhnlich nicht mehr so nahe ans Dorf, aber wer wusste, wie weit Erich gelaufen war.
Wilhelm kannte die Streitigkeiten der Brüder, bei denen Hans immer nachgab. Was aber, wenn er dieses eine Mal nicht nachgegeben hatte? Er traute Erich alles zu. Er war ein Heißläufer und würde einfach hinaus in die Nacht rennen.
„Emine, geh zu Ana“, sagte er, „und bitte sie, die Frauen im Dorf zu fragen, ob die Kinder ihn gesehen haben. Vielleicht ist er mit jemandem mitgegangen?“
Emine nahm die Pfanne ohne Eile vom Herd.
„Lauf, blödes Weib“, herrschte Wilhelm sie an, dann stürmten sie aus der Küche. Vor dem Haus warteten die Männer mit den Fackeln, Hassan hatte seinen Sohn Pamir dabei.
„Hast du Erich gesehen?“, fragte Wilhelm ihn.
Pamir schüttelte den Kopf.
„Du kannst es mir ruhig sagen, ich werde dich nicht bestrafen.“ Er trat einen Schritt auf den Knaben zu, der mit seinen dreizehn Jahren fast so groß war wie er selbst.
Pamir wich seinem Blick nicht aus. „Nein“, sagte er.
Читать дальше