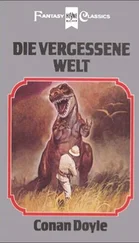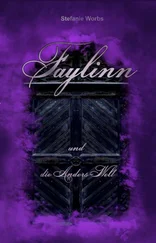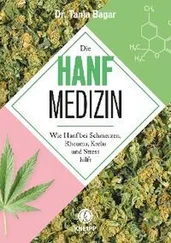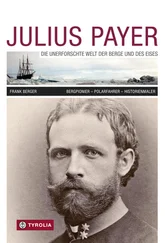***
Wilhelm hatte nicht nur zugestimmt, dass auch sie Französischunterricht bekäme – er hatte sie dazu gedrängt. Maria hatte nur die Grundschule abgeschlossen. Eine darüber hinausgehende Ausbildung war ihren Eltern als unnötiger finanzieller Aufwand erschienen. Fritz ja, der sollte auf die Höhere Technische Lehranstalt gehen, dafür sparten sich Vater und Mutter die Bissen vom Mund ab, aber Maria? Was für eine Verschwendung!
Wilhelm kannte das Potential seiner Frau. Nichts fürchtete er mehr, als wenn sie anfinge, sich in Bünyan zu langweilen. In den ersten Jahren hatte sie sich – sehr zum Unwillen der Dienstboten, die nicht verstanden, warum sich Maria partout die Hände schmutzig machen wollte – sehr mit dem Garten beschäftigt. 1896 begann sie, bereits hochschwanger, direkt vor dem Haus zwei Blumenbeete anzulegen. Emine hatte den Kopf geschüttelt: Blumen! Wozu Blumen? Die konnte man ja doch nicht essen! Und direkt vor dem Haus die Beete, wo sie alle sahen. Wie unnötig. Hinter das Haus gehörte ein Beet.
Viel gab es sowieso nicht zu ernten. Erst die ewige Schneedecke, dann versank im Frühling alles im Morast. Bald darauf war es so heiß, dass die Erde sich zu einer knöchernen Faust verschloss, der man nur mit Mühe ein Pflänzchen abringen konnte. Im Sommer verdorrte dann ohnehin alles. Kartoffeln, Mais und Kürbis hielten sich nur in der schattigen Schlucht, wo sie in karstigen Mulden vor dem Wind geschützt lagen.
Und doch hatte Maria in nicht einmal fünf Jahren dem ungünstigen Klima einen kleinen Bauerngarten abgerungen. Astern, Knoblauch und Ringelblumen wuchsen hier in schöner Eintracht mit den Feuerbohnen, die sich an langen Stangen hochrankten. Maria hatte einen Kompromiss mit Emine geschlossen: Es durfte auch Gemüse angebaut werden, im Gegenzug blieben die Beete vor dem Haus. In den letzten beiden Jahren war Marias Interesse an dem Garten erlahmt. Vielleicht waren Hans und Erich zu oft über die noch zarten Setzlinge getrampelt. Auch wenn Emine sie dann mit dem Besenstiel verfolgte und Wilhelm ihnen Prügel androhte – es half nichts. Immer wieder vergaßen sie nach dem Winter, dass die Beete gleich neben dem Eingang lagen. Oder es war ihnen egal. Wilhelm vermutete Zweiteres.
Das Wiehern eines Pferdes vor dem Haus riss Wilhelm aus seinen Gedanken. Noch lag alles unter einer hohen Schneedecke. Im Winter gab es für Maria außer gelegentlichen Besuchen bei der Frau des Paschas und Stickarbeiten nichts zu tun. Dabei hasste sie Stickarbeiten. Lieber hätte sie sich, so war er sicher, mit ihm und dem Pascha über Motorräder unterhalten. Der Pascha hatte ein Faible für Motorräder und zeigte ihm bei jedem Besuch stolz seine Sammlung. Aber da durfte Maria natürlich nicht dabei sein. Ihre geliebten Ausritte, die ihr sonst eine willkommene Abwechslung waren, kamen bei dieser Witterung auch nicht in Frage.
Lange schon lag ihm seine Frau in den Ohren, dass sie sich Kufen wünschte, die sie mit Lederriemen an die Schuhe binden könnte. Sie liebte das Eislaufen, das sie im Winter auf zugefrorenen Seitenarmen der Donau gelernt hatte. Sie wollte auch hier in der Schlucht auf dem Weiher laufen, der monatelang unter einer dicken Eisdecke lag. Bis jetzt jedoch war es Wilhelm nicht gelungen, solche Kufen auf dem Bazar in Konstantinopel aufzutreiben – wo es dort doch angeblich alles gab, was ein menschliches Auge je erblickt hatte.
Um den Haushalt und das Essen kümmerte sich Emine, um die Kinder Ana – und jetzt auch Monsieur Bertrand. Warum sollte er nicht auch Maria ein paar Sätze Französisch beibringen? So könnte sie in Kayseri, bei einem der seltenen Empfänge für die Eisenbahningenieure und ihre Familien, ein bisschen Konversation machen. Englisch sprach sie nicht – und ihr österreichischer Dialekt brachte den deutschen Kollegen immer zum Lachen. Niemand sollte seine Frau auslachen, und schon gar nicht der! Auch wenn es Maria nicht zu stören schien.
Erst hatte sie der Idee, dass auch sie mit den Kindern Französisch lernen sollte, wenig abgewinnen können. „Erinner dich, wie eifersüchtig du auf den Fritz warst, dass er auf die Technische Lehranstalt durfte und du nicht. Bis heute hast du das deinem Vater nicht verziehen“, hatte er zu Maria gesagt. „Du fandest das ungerecht. Und jetzt darfst du etwas lernen und willst nicht.“ Schließlich hatte sie zugestimmt, sich den Franzosen einmal anzusehen und dann ihre Entscheidung zu treffen.
Bei der ersten Begegnung war sie sehr zurückhaltend gewesen und hatte Wilhelm das Reden überlassen, was selten genug vorkam. Wie souverän der Franzose vom Pferd stieg. Das war sein erster Gedanke gewesen. Er selbst hatte Angst vor Pferden und hatte sich nur schwer mit der Leidenschaft Marias für diese unberechenbaren Tiere abgefunden. Schwarz-weiß gescheckt war jenes, das ihn als Kind gebissen hatte. Wilhelm erinnerte sich genau an die aufmunternden Worte des Vaters, dem Gaul das Zuckerstückchen hinzuhalten, das er doch lieber selbst gegessen hätte. „Auf der flachen Hand, es ist ganz einfach.“ Und doch hatte er im letzten Moment die Finger zur Faust geschlossen, erschreckt über die Rauheit der Zunge und das Pferdegesicht mit den großen Nüstern auf Höhe seines Gesichts. Und er erinnerte sich an die Überraschung über den Schmerz. Es tat nicht sehr weh. Schlimmer war, dass das Zuckerstück nun verdorben war durch das Blut auf seinen Fingern. Es schmeckte süß und metallisch zugleich.
Wilhelm hatte den Franzosen ins Haus und zum Kaffee hinauf in den Salon gebeten. Dieser überschlug ungeschickt seine Beine, als sie in der osmanischen Ecke Platz nahmen. Erst das rechte Bein über das linke, dann doch umgekehrt, so als wären ihm seine Gliedmaßen zu lang oder gänzlich unbekannt. Dabei war er nicht besonders groß, Wilhelm überragte ihn um fast einen Kopf und konnte ihm auf den ordentlich gezogenen Scheitel sehen, mit dem er sein blondes Haar akkurat zu teilen versuchte. Die Locken waren ihm durch den Ritt aber durcheinandergekommen, eine Strähne stand hoch. Dazu die Nickelbrille. Was für ein Träumer, hatte Wilhelm gedacht.
Erst wurde nur besprochen, ob Monsieur Bertrand bereit sei, die Kinder zu unterrichten. Wie oft im Monat es ihm möglich wäre, den weiten Weg herauf zu reiten, und wie viel Wilhelm dafür bezahlen würde. „Tant pis“, waren Monsieur Bertrands erste Worte gewesen, als Wilhelm die Summe genannt hatte. Wie meinte er das, der Franzose? Er entknotete umständlich seine Beine und Wilhelm war in Sorge, er würde das Haus sofort verlassen, er, Wilhelm, habe eine zu niedrige Summe genannt. Aber als Monsieur Bertrand seine Beine endlich in Stellung gebracht hatte, bat er freundlich um eine Hausführung. Wilhelm zeigte ihm sein Arbeitszimmer und sah mit Genugtuung, dass der Franzose seine Pinselsammlung bemerkte. Fast hätte er die Hand nach dem Dachshaar ausgestreckt, besann sich aber.
„Et les enfants?“, fragte Monsieur Bertrand, und Wilhelm schickte Maria, Ana zu holen, die mit den Kindern in der Küche saß. Er verstand nicht, warum der Franzose die Buben sehen wollte. Zweifelte er etwa an ihrer guten Erziehung? War man sich erst über den Preis einig, würde sich der Rest schon fügen. Der Franzose lächelte nicht, als Ana mit den Buben – einen rechts, einen links an der Hand – vor ihn trat. Erst als sich Hans halb hinter ihrem Rock versteckte, ging er in die Knie und brachte sein Gesicht auf die Höhe des Knaben. „Ich bin Frederic“, sagte er. Wilhelm war mehr als überrascht, dass der Franzose Deutsch sprach.
„Frederich“, sagte Monsieur Bertrand, und es klang wie Fred-Erich. „Ich auch“, sagte der Bub, entwand seine Hand der Amme und streckte sie dem fremden Mann hin, wo er sich doch sonst standhaft weigerte, brav die Hand zu geben. Maria lachte und Frederic lachte mit ihr, während Ana noch verständnislos dastand und versuchte, das freche Kind zurückzuziehen.
Читать дальше