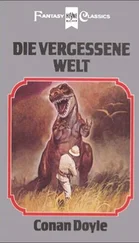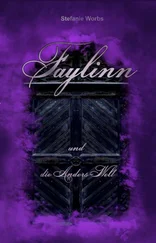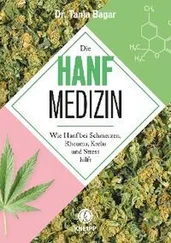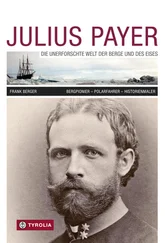Hassan trat an ihn heran und wollte die Stoffballen auf dem Tisch ablegen. Aber Wilhelm wies ihn mit einer Kopfbewegung in ihre „osmanische Ecke“. Neben den westlichen Möbeln gab es in dem Raum auch einen prachtvollen Kelim, der, flankiert von drei ledernen Puffs, auf einem niedrigen Podest lag. Dort nahmen sie Platz. Wilhelm bot Hassan eine Wasserpfeife an, er selbst blieb bei seiner Lese-Pfeife aus Bruyère-Holz, ein Geschenk seines Vaters – das einzige. Er zog gedankenverloren an dem langen Mundstück, während Hassan mit der Wasserpfeife hantierte. Als sie lange genug geschwiegen hatten, rollte der das Leinen vor Wilhelm aus.
Wilhelm ergriff den Stoff und fuhr mit der flachen Hand gegen den Strich. „Es ist anders als sonst“, sagte er. „Du weißt genau, dass ich das gleiche will wie beim letzten Mal.“
„Es ist das gleiche.“
„Nein.“
„Es ist das Sommerleinen“, sagte Hassan, „nicht das Winterleinen.“
„Es ist dünner als das letzte Mal“, beanstandete Wilhelm.
„Es ist das Sommerleinen“, wiederholte Hassan, „und es ist so dünn wie immer.“
„Das kann nicht sein. Ich täusche mich nicht“, sagte Wilhelm und strich erneut über den Stoff.
Hassan bereute schon, nicht noch länger gewartet zu haben. Er hatte geahnt, dass heute ein schwieriger Tag war für Wilhelm. Wenn bloß Emine ihn nicht so bedrängt hätte! Jetzt war es zu spät, und er musste seinen Plan weiterverfolgen.
„Der Stoff ist wie immer aus Konstantinopel vom großen Bazar“, beteuerte er. „Und Monsieur İpek hat ihn wie immer persönlich ausgesucht und die Versendung überwacht.“
„Dann ist er hernach vertauscht worden. Oder du selbst hast ihn vertauscht, um mich zu betrügen.“
Hassan seufzte. Das ging zu weit! Eine derartige Beleidigung konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Der Plan war hin! Mit einer Handbewegung rollte er den Stoff ein und erhob sich. Gerade, als er hinausstürmen wollte, brachte Emine den Kaffee. Sie trieb ihn vor sich her zurück zum Podest. „Was ist hier los? Wollt ihr nicht euren Kaffee trinken?“ Wie sie es sagte, war keine Widerrede möglich. Hassan setzte sich, überschlug die Beine und legte die Stoffballen in größtmögliche Entfernung zu Wilhelm. Emine schenkte ihnen den Kaffee ein und blieb neben dem Podest stehen.
Beide nippten an den winzigen Kaffeetassen. „Der Herr könnte recht haben“, sagte Hassan. „Monsieur İpek ist alt. Seine Augen sind nicht mehr so gut. Vielleicht hat er sich getäuscht und das falsche Leinen gewählt.“
Wilhelm seufzte. „Ja, wir alle werden alt.“ Sie schwiegen eine Weile.
„Was mache ich bloß?“, fragte Wilhelm. „Das Hemd ist hin. Sieh, an den Manschetten hängt kaum mehr ein Faden. Maria hatte recht. Ich habe zu lange gewartet. Und jetzt ist es hin und kein Stoff zu bekommen.“
„Die nächste Lieferung kommt in acht Wochen“, sagte Hassan.
„So lange kann ich nicht warten“, sagte Wilhelm. Sie schwiegen. „Kommt keine Lieferung nach Kayseri?“
„Nein, nicht vor Mai“, sagte der Schneider. „Da fällt mir ein: Die gnädige Frau hatte einen Stoff für ein Tischtuch verlangt. Da ist er. Ein bisschen sehr modern, die Farbe, aber eigentlich ganz brauchbar. Und reißfest. Zur Not.“ Er ließ den Satz auf das ziselierte Tablett sinken, auf dem die Kaffeetassen standen, und betrachtete das blaurote Rautenmuster des Kelims.
Wilhelm verzog das Gesicht. „Der Stoff ist nicht weiß.“
„Doch“, erwiderte Hassan. „Naturweiß. Es wird ein Sommerhemd. Maria wird staunen.“
Wilhelm griff nach dem Ballen. „Es ist gelb.“
„Es ist sommerweiß. Ein neues Hemd. Maria wird sich freuen.“
„Und das Tischtuch?“, fragte Wilhelm.
„Machen wir aus dem falschen Leinen“, sagte Hassan und griff nach dem Ballen mit dem Canfes.
Emine verließ lautlos den Raum. Sie strahlte.
***
Sie ertappte sich dabei, dass sie lauschte. Nicht, was ihr Mann im Nebenzimmer mit dem Schneider besprach, das interessierte sie nicht. Sie lauschte, ob schon das Hufgetrappel zu hören war. Maria öffnete das Kinderzimmerfenster und beugte sich hinaus. Nicht zu weit, die Dienstboten sollten sie nicht sehen. Sie berührte mit der Hand die meterdicke Steinmauer. Immer noch eiskalt. Auch kein Geruch von Frühling. Dafür würde er schneller da sein, wenn das Pferd nicht im Morast versank. Einundzwanzig Meilen waren es von Kayseri herauf nach Bünyan. Für eine geübte Reiterin wie sie, die den Weg kannte, leicht in zwei Stunden zu schaffen. Er würde länger brauchen, mindestens drei Stunden.
Es war kalt, sie schloss das Fenster. Monsieur Bertrand. Es war Wilhelms Idee gewesen, ihn als Hauslehrer für die Buben einzustellen. Ihr war das übertrieben erschienen. Hans war erst fünf, und Erich, der war ja überhaupt noch ein Kleinkind mit seinen bald vier Jahren. Aber Wilhelm hatte darauf bestanden.
Monsieur Bertrand war beim Pascha in Kayseri angestellt und wohnhaft. Er unterrichtete dessen zwei älteste Söhne in Französisch. Daneben blieb ihm Zeit, auch die Kinder der in der Provinzhauptstadt ansässigen deutschen und britischen Ingenieure zu unterrichten. Viele waren es nicht, die ihre Familien hatten nachkommen lassen. Die meisten wären gar nicht auf die Idee gekommen, ihre Frauen diesen Strapazen auszusetzen. Nur der Rheinländer hatte Frau und Tochter da, der Brite lebte mit Gattin und zwei Söhnen in einem prächtigen Steinhaus im Zentrum. Also hatte Monsieur Bertrand eine Klavierschülerin und gerade einmal vier Zöglinge in Französisch.
„Wir können ihn fragen“, hatte Wilhelm gesagt.
„Er wird den weiten Weg nach Bünyan nicht auf sich nehmen wollen“, hatte Maria geantwortet.
„Er stirbt vor Langeweile. In Kayseri gibt es für einen Franzosen nicht viel zu tun. Und nach Angora 2sind es über zweihundert Meilen. Da kommt er nur alle heiligen Zeiten einmal hin. Er ist für jede Abwechslung dankbar. Und der Pascha ist ein weiser Mann. Er wird es ihm erlauben. Sonst ist sein Monsieur Bertrand vor dem nächsten Winter weg. Nicht alle sind für Anatolien gemacht.“
Sie hatten ihn eingeladen. Und wirklich schien Monsieur Bertrand nicht abgeneigt, den Weg einmal die Woche auf sich zu nehmen. Die Kinder waren ungewöhnlich brav gewesen. Besuch kam nicht oft nach Bünyan. Sie bestaunten den zartgliedrigen, blonden Mann, der in einer großen Ledermappe zwei Bücher mitgebracht hatte: eine Französischgrammatik, die Hans und Erich nicht interessierte. Sie konnten nicht lesen. Und einen Atlas, in dem er ihnen zeigte, wo sie jetzt lebten, wo die Eltern herkamen und woher er selbst: aus Dijon. Von so weit weg!
Die Kinder liebten ihn vom ersten Augenblick an. Maria hatte sich nicht viel erwartet. Er machte keine gute Figur auf seinem Rappen, als er das erste Mal eintraf. Hassan musste das Pferd halten, damit er absteigen konnte. Er war ein Bücherwurm – und ein Städter. Was ihn nach Anatolien verschlagen hatte, mochte Maria nicht in den Sinn. Abenteuerlust? Eher Geldmangel. Er klopfte sich den Dreck von den Stiefeln, ehe er ins Haus trat. Immerhin Manieren hat er, hatte sie sich gedacht.
Und jetzt wartete sie, ob Pferd und Reiter pünktlich auf der alten Karawanenstraße in Sicht kommen würden. Wie jeden Sonntag. Als sie das Pferd hörte, trat sie im Fensterrahmen zurück. Aber sie sah, dass er heraufschaute, bevor er Hassan das Pferd überließ. Die Kinder polterten ihm schon die Stiegen hinunter entgegen: „Frederic“, riefen sie, „was hast du uns heute mitgebracht?“ Mit Erich auf dem Arm schnaufte er die Treppe herauf, Hans hinterher.
„Was habe ich da? Einen Theodolit“, sagte er, setzte Erich auf dem Tisch im Kinderzimmer ab und holte den Schatz hervor. Ein außergewöhnliches Gerät: ein goldenes Fernrohr auf zwei Waagschalen über einer Uhr. Maria trat näher, um es betrachten zu können. Sie erkannte es. Auch Wilhelm arbeitete beim Eisenbahnbau damit. Aber nie wäre er auf die Idee gekommen, es so kleinen Kindern in die Hand zu geben. Frederic traute den Buben alles zu. Er hatte keine Angst, dass sie etwas kaputt machen könnten. Dafür liebte sie ihn. Wie sehr, darüber war sie sich noch nicht im Klaren.
Читать дальше