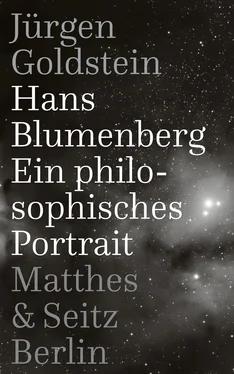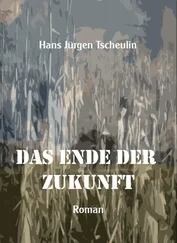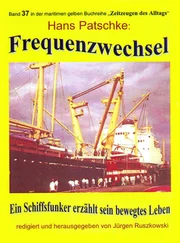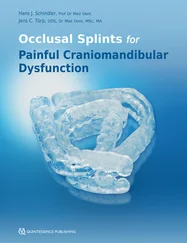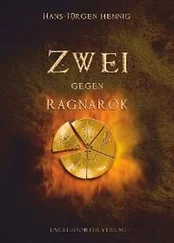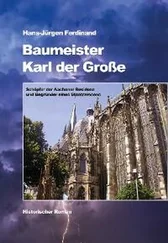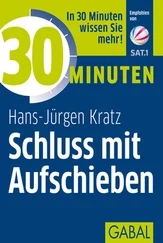Im Rückblick und mit größerer Distanz zu Husserls Vorhaben, die Geschichte der abendländischen Theorie auf die Phänomenologie zulaufen zu lassen, erscheint Blumenbergs Identifikation der Neuzeit mit dem cartesischen Willen zu absoluter Klarheit und Deutlichkeit freilich als allzu enggeführt. Ein einziger Blick etwa in die Genesis der kopernikanischen Welt reicht zur Verdeutlichung, wie sehr Blumenberg selbst sein frühes Bild von der modernen Wissenschaft korrigiert, erweitert und vertieft hat. Schon in seinem Aufsatz »Weltbilder und Weltmodelle« aus dem Jahr 1961 weist er die alleinige Verbindlichkeit cartesischer Leitvorstellungen für das moderne Theorietreiben zurück, sei doch offensichtlich, »daß die Funktion der Wissenschaften in unserer gegenwärtigen Wirklichkeit nichts mehr mit den Motiven ihres frühneuzeitlichen Ursprunges gemein hat«. 167
Doch lohnender als eine Kritik an den Stilisierungen und unhistorischen Vereinfachungen, die sich die Habilitationsschrift noch erlaubt, ist ein Blick darauf, wie der überscharfe Kontrast vom Streben nach absoluter Gewissheit und Endlichkeit des Denkens die weitere Physiognomie von Blumenbergs Philosophie geformt hat. Ich möchte das mithilfe von einigen locker gereihten Anmerkungen andeuten.
Eine der zentralen Bedingungen der modernen Organisation von ontologischer Distanz durch die Wissenschaft ist die Verpflichtung auf das Einhalten methodischer Vorgaben. Erst mit Descartes hat das methodisch abzusichernde und zu verantwortende Vorgehen in der Wissenschaft die heutige dominante Stellung erlangt – man denke an Platons Dialoge oder an die ›scholastische Methode‹ des Hochmittelalters, um sich die Radikalitätsdifferenz zur modernen Methodologie vor Augen zu führen. Die neuzeitliche methodische Disziplinierung des Forschens zielt nach Blumenberg auf eine »Eliminierung der Subjektivität«, 168die in ihrer konkret-faktischen Gestalt gleichsam einer Verunreinigung der Wissenschaft gleichkommt. »Methode ist das Organon, behilfs dessen sich der wissenschaftliche Geist der Zufälligkeit und Endlichkeit der forschenden Individuen enthebt und sich der Befangenheit im faktischen geschichtlichen Dasein entzieht.« 169Insofern die absolute Gewissheit nicht in einem einzigen Schritt zu erreichen ist, sondern der Fortschritt auf Dauer gestellt werden muss, wird jeder Einzelne »zum Funktionär des szientifischen Prozesses der Gewißheitsbildung reduziert«. 170Die den wissenschaftlichen Fortschritt über Generationen versichernde Methode, an die sich alle Wissenschaftstreibenden zu halten haben, stellt dem ideellen Erkenntnissubjekt ›Menschheit‹ in Aussicht, was sie dem Einzelnen an Erkenntnis vorenthält.
Der in der Habilitationsschrift entwickelte Methodenaspekt der modernen Wissenschaft war Blumenberg so wichtig, dass er 1952 einen Aufsatz mit dem Titel »Philosophischer Ursprung und philosophische Kritik des Begriffs der wissenschaftlichen Methode« veröffentlichte. Von ontologischer Distanz ist darin schon nicht mehr die Rede, aber es werden auf knappem Raum die modernen Methodenansprüche mit einem Verständnis von Philosophie konfrontiert, für das das Ideal einer ›strengen Wissenschaft‹ nicht verpflichtend ist. Der Aufsatz liest sich als ein Befreiungsschlag, der dem Philosophieren Luft zum Atmen verschaffen und die Freiheit des Denkens jenseits methodischer Überregulierung garantieren soll.
Dazu verweist Blumenberg zunächst darauf, der ursprüngliche Wortsinn von méthodos sei: einer Sache nachgehen, etwas verfolgen, ganz im Sinne des räumlich-bewegungsmäßigen Nachsetzens. Im übertragenen Sinne verlange die methodisch ausgerichtete Theorie, einem Sachverhalt nachzugehen. »Immer bleibt das Gegebene, sei es real oder ideal, in seiner eigenen Bewegtheit im Blick.« 171Darauf kommt es an: Diese Art des methodischen Verfolgens lässt sich vom Gegenstand leiten, bestimmen, führen. Die Methode habe sich im Laufe der Geschichte dann aber in eine Technik verwandelt, wodurch das Wie einer Untersuchung in den Vordergrund gerückt und der Gegenstand aus seiner leitenden Funktion entlassen worden sei: »Der Erkennende heftet sich nicht primär an die Sache, sondern orientiert sich im Entwurf eines Ideenzusammenhanges, eines ›Systems‹, und die Sache hat ihre Bedeutung vornehmlich darin, daß sie die vorentworfene Topographie des Systems ›bestätigt‹.« 172Schlimmer hätte es kaum kommen können.
Für den Umgang mit Blumenbergs späteren Büchern ist die Beachtung von seinem als ›ursprünglich‹ ausgewiesenen Verständnis von Methode von überragender Bedeutung. Übersieht man seinen im Kern vormodernen Methodenbegriff, sind Irritationen vorprogrammiert, denn Blumenberg hat sich in seinen Schriften nicht dem Diktat der modernen Methodologie gebeugt. Daher rührt auch der berechtigte Eindruck, es mit einem ungemein souveränen, selbstbewussten und freien Denker und Autor zu tun zu haben. Blumenberg philosophiert aber auch nicht aus Prinzip wider den Methodenzwang, sondern legt seiner Philosophie eben jenen für ihn originären Methodenbegriff zugrunde. Etwa in den Paradigmen zu einer Metaphorologie : Nach wenigen Seiten Einführung, die nur die notwendigsten Bestimmungen und methodischen Auskünfte bieten, geht Blumenberg gleich ins ›Quellenmaterial‹ und lässt sich von den Metaphern leiten. Zwar bietet er für sie paradigmatische Typologien, aber es ist erkennbar das Ziel, sich vom zu Deutenden her bestimmen zu lassen. Blumenberg verweigert sich einer vorlaufenden Systematik, die die zu interpretierenden Metaphern zu reinen Bestätigungen verkommen lassen könnten. Es ist von hohem Aufschlusswert, dass Blumenberg im Rahmen der zu entwickelnden Metaphorologie zuerst einen Aufsatz, der den Paradigmen zeitlich noch vorausgegangen ist, vorgelegt hat: »Licht als Metapher der Wahrheit« aus dem Jahr 1957. Er wendet sich gleich dem ›Material‹ zu und verlässt sich auf systematische Grundintuitionen, die sich an den Quellen zu bewähren haben. Das setzt so etwas wie intellektuellen Spürsinn voraus, eine Kunst der Vermutung, das Vertrauen auf die eigene Intuition der Ahnung.
Zugleich verlangt es die Kunst der Selbstzurücknahme. Blumenberg hat sich dagegen ausgesprochen, ein ausdrückliches Selbstverständnis pflegen und vorweisen zu müssen. Er habe keinerlei ›Interesse‹ – die Leitvokabel von Habermas’ Erkenntnis und Interesse durch Anführungszeichen auf Distanz gesetzt – an einem Selbstverständnis: »Es stört dabei, das zu verstehen, was man doch vor allem, wenn nicht ausschließlich, verstehen möchte.« 173Insofern das leitende Interesse als der Ausgriff eines vereindeutigten Selbstverständnisses auf etwas zu Untersuchendes genommen werden kann – in der Art: ›Ich als Soziologe interessiere mich für gesellschaftliche Ungerechtigkeiten in einem Stadtteil von Berlin‹ –, sucht die gewollte Interessenlosigkeit mit der Variabilität möglicher Selbstverständnisse jene Elastizität des theoretischen Nachverfolgens, bei der ein festgelegtes Selbstverständnis nicht beschränkend im Weg steht. Leitend ist für Blumenberg daher nicht das fokussierte ›Interesse‹, sondern die wahrnehmungsoffene ›Neugierde‹, nicht das ›Problem‹, sondern das ›Phänomen‹.
Dem ursprünglichen Methodenbegriff, der sich vom zu erkennenden Gegenstand leiten lässt, entsprechen Wissensformen, die inzwischen jenseits der strengen Wissenschaft angesiedelt sind: etwa der Bericht oder die Erzählung. 174Beides kultiviert Blumenberg in seinem Werk, indem er von ›Gipfeltreffen‹ zwischen Geistesgrößen berichtet – etwa Marcel Proust und James Joyce – und indem er große Bögen der Bewusstseinsgeschichte nacherzählt. Daher rührt der Verdacht aller in der modernen Methodologie Gefestigten, hier verkomme jemand zum ›erzählenden Philosophen‹, der von Anekdoten berichte.
Читать дальше