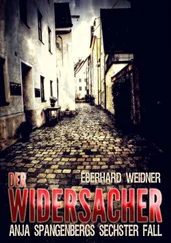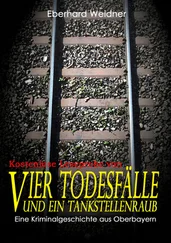Der Mann sah sich Hilfe suchend mit feuchten Augen um. Es war offensichtlich, dass er starke Schmerzen hatte.
Georg wandte sich den Männern zu: »Hat jemand von euch noch etwas Verbandstoff oder etwas, was man als Verband verwenden könnte?«
Einer der Männer fand in seinem Brotbeutel eine nicht mehr ganz saubere Mullbinde und gab sie dem Verwundeten. Der nahm sie dankbar an und ließ sich den alten Verband abwickeln. Der noch brauchbare Teil des Verbandes wurde aufgerollt und von dem letzten blutverkrusteten Verbandsstück mit Georgs Taschenmesser abgetrennt. Dann handelte der Verwundete selber. Er drehte seinen Kopf zur Seite und riss mit einem Ruck, die mit der Wunde verklebte Mullauflage ab, schrie vor Schmerz auf und blickte dann angewidert auf das, was er da freigelegt hatte. Die Wunde rührte von einem Granatsplitter, der den rechten Unterarm aufgeschlitzt hatte. Der Mann hatte noch Glück gehabt, denn der Knochen war unversehrt geblieben. Der heftige Ruck an der Mullbinde hatte an einigen Stellen den Wundschorf aufgerissen. Kleine Blutrinnsale hatten sich neu gebildet und liefen über feuerrote Wundränder, die schon längst hätten zusammengenäht werden müssen. Wenn der Mann das Lager überstehen sollte, würde er ein Leben lang mit einem verkrüppelten Unterarm, der zu nichts mehr taugte, herumlaufen. Georg sah in das vor Schmerz verzerrte Gesicht des Mannes und verfluchte sich, weil er nicht helfen konnte. Er verfluchte aber auch die Amerikaner, weil sie die Verwundeten nicht einmal von den gefangenen deutschen Sanitätern behandeln ließen.
Steinmetz hatte an einer Sanitäterausbildung teilgenommen und versuchte nun zu helfen. Während einer der Männer den Arm des Verwundeten festhielt, zog Steinmetz Reste der mit der Wunde verklebten Mullbinde mit Hilfe zweier Streichhölzer heraus, die er wie eine Pinzette benutzte. Dann nestelte er an seiner Brusttasche herum und zog ein großes Taschentuch heraus. Daraus bildete er einen langen schmalen Tuchstreifen und legte ihn der Länge nach auf die Wunde. Anschließend wickelte er die Mullbinden um den Arm, die gebrauchte zum Schluss. Dankbar sah ihn der Verwundete an und wollte etwas sagen. Steinmetz hängte ihm die Uniformjacke über die Schultern und kam ihm zuvor: »Ist schon gut! Das sind wir uns doch schuldig!«
Ganz allmählich löste sich ihre schweigsame Betroffenheit. Sie begannen ihre Situation so anzunehmen, wie sie im Augenblick war, und bauten sich nun Krücken, um mit ihr zurechtzukommen, indem sie Regeln aufstellten: Diebstahl etwa sollte mit dem Ausschluss aus der Schutzgemeinschaft bestraft werden. Denn überall, wo Mangel herrscht, wird auch der unbedeutendste Gegenstand, der das nackte Überleben sichern helfen kann, zum Gegenstand der Begierde und weckt die niedrigsten Instinkte im Menschen.
Georg sah hin und wieder zu dem Rest der Gruppe hinüber, der mit ihnen hierher getrieben worden war, und bemerkte, dass sich auch dort ein paar größere Gruppen gebildet hatten. Dazwischen saßen oder standen aber auch verlorene kleine Gruppen oder sogar einzelne Soldaten. Zwei Männer fielen ihm dabei wegen ihrer schwarzen Uniformen auf. Es waren Panzersoldaten, die sogar jetzt noch ihre gepolsterten Kopfschützer trugen.
Die tief hängende Wolkenschicht entließ feine Nieselregenschleier, die die Konturen der Landschaft wie in einem schlecht gemalten Aquarell mit trüben Farben von Schwarz über Schmutzigblau bis Wassergrau ineinander verschwimmen ließen. Das Lager selbst nahm die gesamte tischebene Fläche auf dem Westufer des Rheins ein. Die Stacheldrahtzäune verschmolzen zu grotesken Figuren mit dem Grau des Himmels und dem des Rheins. Sie schienen Bestandteile dieses Graus zu sein, ja geradezu aus ihm herauszuwachsen. Die harten Linien waren nur noch zu erahnen oder hatten sich aufgelöst. Dort, wo sie nicht mehr zu sehen waren, hoben sie die Grenze zur Außenwelt auf und erzeugten die Illusion, durch den Zaun hindurchgehen zu können. Das Ostufer des Rheins war als dicker schwarzer Balken in dem Grau auszumachen. Es erhob sich steil und endete als hochgehobene Fläche, auf der ein helleres Grau auflag. Irgendwo im Nordwesten versteckten sich die Ahrberge in dem Dunstschleier. Davor bohrten sich die Türme einiger hoch gelegener Kirchen und Schlösser seltsam verdreht in die Nebelfetzen.
Sie saßen jetzt schweigend, jeder seinen Gedanken nachhängend, eng zusammengedrängt und sich gegenseitig wärmend, auf den ausgebreiteten Zeltbahnen. Die Zeltbahnen boten ihnen zwar einen trockenen Sitz, sie konnten aber nicht verhindern, dass die feuchte Kälte des Bodens durch sie hindurchkroch und sich in ihre Kehrseite krallte.
Der Tag ging übergangslos in eine von grauen Wolkenmassen gefärbte Dämmerung über, die ihre erste Nacht im Lager ankündigte. Der feine Nieselregen drang allmählich durch die tief heruntergezogenen Mützen, fand seine Bahn durch hochgeschlagene Mantelkrägen und ließ die Rücken der Gefangenen frösteln. Aber langsam wurde ihnen wärmer. Das dichte Aufeinanderhocken erzeugte eine Wärme, die die Feuchtigkeit, die von ihren Körpern und aus ihrer Kleidung aufstieg, in einer nebelhaft verdampfenden Dunstschicht über ihnen sichtbar machte. Zu dem sauren, pelzigen Geschmack des Hungers auf ihren Zungen schmeckten sie jetzt ihre eigene abgestandene Wärme, die sie an den seifigen Geschmack dampferfüllter Waschküchen erinnerte. Nur der Geruch war anders.
Aber es gab etwas, das selbst hier Trost spenden konnte, jedenfalls für Georg. Seine Hand fuhr in die Uniformjacke und holte eine von einem Einkochglasgummi zusammengehaltene lederne Brieftasche hervor. Sie war ziemlich dick, ohne das Gummiband wäre der Inhalt herausgequollen. Er öffnete sie nicht, um den kostbaren Inhalt nicht nass werden zu lassen. In diesem Augenblick genügte es ihm, die Brieftasche nur zu umklammern und festzuhalten. Die Briefe darin waren dem Datum nach geordnet und waren von seinen Eltern und von Marie geschrieben worden. Die meisten, es waren auch die längsten, waren von Marie. Georg nahm sich vor, jeden Abend, wenn es nicht regnete, einen der Briefe zu lesen. Er kannte sie zwar alle schon auswendig, aber sie würden ihm das, was er am meisten vermisste, auch an diesen trostlosen Ort holen. Seine Finger umschlossen die Brieftasche mit hartem Griff, fanden und verschränkten sich und führten die Hände unwillkürlich zum Gebet zusammen. Ungeordnete Gedanken, gestammelte Wortfetzen schossen ihm plötzlich durch den Kopf, bildeten Worte, Sätze, bis sie sich schließlich in einem Gebet wiederfanden. Erst als ihm die Bitte einfiel, Gott möge den verdammten Krieg endlich beenden, wurde ihm bewusst, dass für ihn und seine Kameraden hier der Krieg vorbei war. Anderswo im Reich wurde aber noch gekämpft. Bis vor ein paar Tagen waren in den Nächten die von Nordwesten einfliegenden Bombergeschwader zu hören gewesen. Jetzt, wo der Himmel sich wieder zugezogen hatte und die Bomberpiloten keine freie Sicht mehr hatten, waren die Nächte zwar wieder ruhig, aber der Krieg schien nur zu schlafen und neue Kräfte zu sammeln.
Georg atmete tief durch und fühlte sich auf eine seltsame Art erleichtert. Er hatte sich wieder dem anvertraut, den seine Mutter und Pfarrer Hülsenbeck ihm immer als letzte Zuflucht empfohlen hatten. Er hatte sich dem anvertrauen können, von dem er nicht wusste, ob er ihm überhaupt zugehört hatte oder ob er überhaupt da war – und wenn er da war, ob er für ihn da war.
Plötzlich war auch das Gefühl wieder da, das ihn mit Unterbrechungen schon seit ein paar Tagen immer wieder überkam. Es kam aus der Körpermitte und machte sich in allen Gliedern bemerkbar. Eine dumpfe Faust schien seinen Magen zu umklammern. Hin und wieder spürte er ein Stechen und Ziehen, das bis in die Gesäßmuskeln und Oberschenkel kroch und dort wütend verharrte. Dann wieder kroch dieses Gefühl nach oben in den Brustkorb, engte ihn ein und füllte seine Mundhöhle mit einem eigenen Geschmack. Es war der Geschmack des Hungers. Er lag auf seiner pelzigen Zunge und schmeckte nach fadem Speichel. Wann hatte er eigentlich zum letzten Mal richtig gegessen? Er erinnerte sich nur noch an eine Hand voll Kekse und an Haferflocken, die er trocken heruntergewürgt hatte. Da fiel ihm der Apfel ein, den ihm heute Morgen – war das wirklich erst heute Morgen gewesen? – eine alte Frau zugeworfen hatte. Georg erhob sich langsam und kramte den Apfel hervor. Es war ein schöner Apfel, und es war ein großer Apfel! Er rieb ihn an seinem Mantel, hob ihn an die Nase, nahm den Duft wahr und biss vorsichtig hinein, fast ehrfürchtig, so, als wolle er ihm nicht wehtun. Er spürte, wie der Saft des Fruchtfleisches den Kampf mit dem Geschmack des Hungers aufnahm – und gewann. Langsam kauend kostete er diesen ersten Bissen aus und ließ sich Zeit mit dem zweiten. Seine Zunge spürte lange der frischen Säure des Apfels nach und versuchte den Geschmack festzuhalten. Bedächtig verzehrte er ihn, nichts blieb am Ende übrig. Er konnte sich nicht erinnern, jemals so lange an einem Apfel gegessen zu haben.
Читать дальше