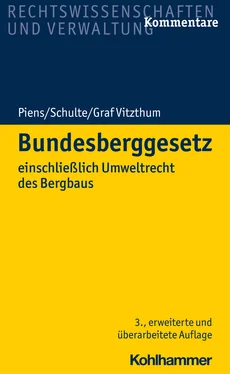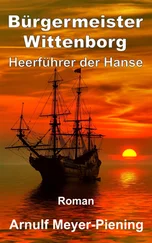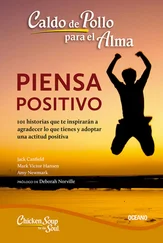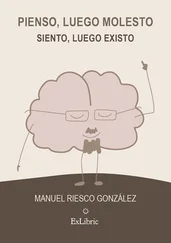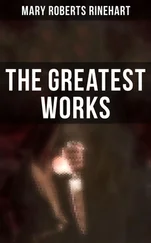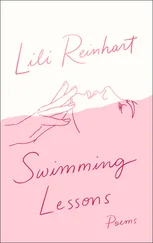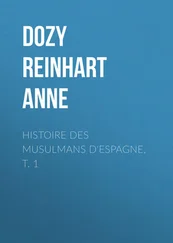79 Weitere Folgerungenfür die Entscheidung der Bergbehörde über die Zulassung des Abschlussbetriebsplans und des Sonderbetriebsplans „Grundwasseranstieg“ trotz Einwendungen betroffener Grundstückseigentümern ergeben sich aus dem sog. Moers-Kapellen-Urteil (BVerwG, 81, 329 = NVwZ 1989, 1157 = ZfB 1989, 199). Danach hat der Grundstückseigentümer einen auf § 48 Abs. 2 gestützten Anspruch, bei zu erwartenden schweren Schäden am Verfahren der Betriebsplanzulassung beteiligt und – materiell rechtlich – in seinem Eigentum gegenüber unverhältnismäßigen Beeinträchtigungen durch den Bergbau geschützt zu werden. Sind nur kleine und mittlere Schäden im üblichen Umfang zu erwarten, sind die Betroffenen – verfahrensrechtlich – im Betriebsplanverfahren nicht zu beteiligen und – materiellrechtlich – auf den Ausgleich des Bergschadenrechts verwiesen.
80Aber auch bei „schweren Schäden vom Ausmaß eines Gemeinschadens“ (BVerwG, a. a. O.) ist die Zulassung des Abschluss- oder Sonderbetriebsplans möglich. Der Grundstückseigentümer hat keinen Anspruch auf Unterlassung dieser schweren Schäden schlechthin, sondern auf angemessene Berücksichtigung seiner Rechtsposition in einer abwägenden Entscheidung am Maßstab des Verhältnismäßigkeitsgebots (Gaentzsch, Oberflächeneigentum und Bergbau, S. 48; Kühne, DVBl 2006, 1220; Frenz, Unternehmerverantwortung S. 18). Etwas anderes ergibt sich auch nicht, wenn man § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 für den Sachgüterschutz außerhalb des Betriebs mobilisieren möchte. Der Personen- und Sachgüterschutz dieser Vorschrift erfasst nur den innerbetrieblichen Bereich (BVerwG, DVBl 2005, 925; Boldt/Weller (2016), § 55 Rn 25; VG Kassel, ZfB 2004, 68, 71; Niermann, S. 188 ff.; Stüer/Wolff, LKV 2002, 13, a. A. noch BVerwG, 89, 246 = ZfB 1992, 40; OVG Berlin, ZfB 1990, 212; VG Berlin = ZfB 1989, 135; Frenz, Unternehmerverantwortung, S. 30 „jedenfalls für Abschlussbetriebsplan“). Im Übrigen ist im § 55 Abs. 2 Nr. 1 das Wort „Sachgüter“ (§ 55 Abs. 1 Nr. 1) nicht mehr enthalten und somit Sachgüterschutz über diese Vorschrift nicht im Abschlussbetriebsplan sicherzustellen (Kühne, DVBl 2006, 1220). Zu den Folgen des Grundwasseranstiegs im untertägigen Steinkohlenbergbauund den Auswirkungen auf die Tagesoberfläche, Schächte, Trinkwassergewinnung und auf Methanaustritte sowie zum sog. Boxmodell: Fischer/Wildhagen, in: Glückauf, 2007, 280 ff. m. w. N.; Baglikow, in: Markscheidewesen 2003, 45 ff.; Sroka/Preuße/Holzheim in Heft 108 der Schriftenreihe des GDMB, S. 57 ff. Ferner hierzu § 53 Rn 74 und § 114 Rn 17.
7.Sonderbetriebsplan „Einstellung der Wasserhaltung“
81Im Sanierungsbergbau werden „Sonderbetriebspläne zur Einstellung der Wasserhaltung aufgestellt, die den zeitlichen Ablauf und die erforderlichen technischen Maßnahmen bei der Flutung der Grube erfassen. Allerdings ist eine Abgrenzung zum Abschlussbetriebsplan und zu etwa erforderlichen wasserrechtlichen Verfahren geboten: Abschlussbetriebspläne können verändert werden durch nachträgliche Auflagen unter den Voraussetzungen des § 56 Abs. 1 Satz 2, durch Widerruf unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 2 VwVfG oder durch eine Anordnung nach § 71, wenn in dem zugelassenen Abschlussbetriebsplan vorgesehene Maßnahmen nicht vollständig durchgeführt werden (Franke, in: Spätfolgen, S. 94). Sofern diese Bestimmungen nicht greifen, können ihre Voraussetzungen nicht durch das Verlangen nach einem Sonderbetriebsplan in Ergänzung eines zugelassenen Abschlussbetriebsplans umgangen werden. Ähnliches gilt im Verhältnis zum Wasserrecht. Das wasserrechtliche Verfahren ist insofern das spezielle für die Anforderungen des Wasserhaushaltes. Im Sonderbetriebsplan „Einstellung der Wasserhaltung“ dürfen sich daher nicht die selben Bestimmungen wiederfinden wie im wasserrechtlichen Verfahren, andererseits dürfen sich die Bestimmungen in beiden Verfahren auch nicht widersprechen.
81aIm Steinkohlenbergbau ist es Praxis, zwischen Beendigung der Produktion und Zulassung des untertägigen Abschlussbetriebsplanes (s. § 53 Rn 58) einzelne Tätigkeiten, die der Vorbereitung der Einstellung des gesamten Bergbaubetriebes dienen, durch Haupt- und Sonderbetriebspläne, z. B. betreffend die Einstellung von Wasserhaltungsmaßnahmen in einzelnen Wasserprovinzen, zu legitimieren (Jordan/Welsing, ZfB 2017, 229, 234). Eine wasserrechtliche Zulassungspflicht für die zeitweilige oder endgültige Einstellung der Grubenwasserhaltung ist demgegenüber nicht gegeben. Der untertägige Teilanstieg des Grubenwassers ist keine Benutzung i. S. § 9 WHG (Einzelheiten s. § 52 Rn 77, § 53 Rn 89i). Anders dagegen, wenn nach Erreichen der bergrechtlich zugelassenen Anstiegshöhe das Grubenwasser abgepumpt und in Fließgewässer eingeleitet wird, um das weitere Ansteigen des Grubenwassers zu verhindern (Jordan/Welsing, a. a. O.; auch ZfW 2017, 121, 131 ff. m. w. N.).
81bDie Zulassungsvoraussetzungen für das bergrechtliche Betriebsplanverfahren zur Einstellung der Grubenwasserhaltung ergeben sich vor allem aus § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, die Standsicherheit alter Schächte betreffend, aus § 55 Abs. 1, Satz 1 Nr. 9, gemeinschädliche Einwirkungen durch Gefahren für die Wasserversorgung betreffend (s. Jordan/Welsing, ZfB 2017, 231, 236 f.) und § 48 Abs. 2, wenn durch schwere Bergschäden eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung des Oberflächeneigentums durch die Zulassung der Einstellung der Grubenwasserhaltung und des damit verbundenen Grundwasserteilanstiegs in Grubengebäude drohen sollte.
8.Anforderungen an Sonderbetriebspläne, Verhältnis zum Hauptbetriebsplan
82Die Zulassung eines Sonderbetriebsplans ist ebenfalls nur von den Voraussetzungen der §§ 55, 48 Abs. 2 abhängig, nicht etwa davon, dass bei einem Vorhaben mit planerischem Gewicht (z. B. Abteufen eines Schachtes) zuvor ein Rahmenbetriebsplan eingereicht und zugelassen ist. Die Zulassung des Sonderbetriebsplans ohne Rahmen- oder Hauptbetriebsplan ist nicht rechtswidrig (s. § 52 Rn 86). Unabhängig davon kann die Bergbehörde von ihrem Ermessen auf Verlangen eines Rahmenbetriebsplans Gebrauch machen (vgl. Rn 22).
Sonderbetriebspläne können nur für bestimmte Teile des Betriebes oder für bestimmte Vorhaben verlangt werden. Dabei muss es sich um technische Maßnahmen handeln, bei denen die Prüfung der Bergbehörde nach den Gesichtspunkten des § 55 einen Sinn hat. Das ist nicht der Fall für rechtliche oder verwaltungsmäßige Folgewirkungen einer betrieblichen Maßnahme, wie z. B. auf Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, nachträglich erlassener Verordnungen oder Richtlinien.
83Im Gesetzgebungsverfahren hat es erhebliche Diskussionen über den Sonderbetriebsplan und darüber gegeben, ob er nicht nur in Fällen besonderer Gefahren für die Sicherheit der Beschäftigten in Betracht kommen könne. Man hat sich für eine uneingeschränkte Beibehaltung des Instituts des Sonderbetriebsplans ausgesprochen. Wenn damit die vom Bergbau geforderte Konzentration auf den Hauptbetriebsplan nicht eingetreten ist, hat diese Regelung für ihn auch Vorteile: die zeitliche Beschränkung des Hauptbetriebsplans entfällt, der Hauptbetriebsplan bleibt spezifisch bergtechnisch und damit weitgehend vom Beteiligungsverfahren nach § 54 Abs. 2 befreit, das mehr in Sonderbetriebsplanverfahren anzuwenden ist. Die gewünschte Abmagerung der Zahl der Sonderbetriebsplanverfahren muss mit Hilfe der zu § 51 Rn 33 ff. vorgetragenen Gesichtspunkte erfolgen.
84Außerdem ist hier noch auf Folgendes hinzuweisen: Das System des Betriebsplanverfahrens geht davon aus, dass der Betriebsplan grundsätzlich vom Unternehmer in eigener Verantwortung aufgestellt wird. Das Verlangen der Bergbehörde nach § 52 Abs. 2 ist in diesem System ein Ausnahmefall. Diese ausnahmsweise Befugnis der Bergbehörde darf nicht dazu führen, in den Betriebsablauf einzugreifen. Es bleibt Sache des Unternehmers, die Art und den Ablauf der bergbaulichen Arbeiten und damit den Inhalt und die Art des Betriebsplans selbst zu bestimmen. Das Betriebsplanverfahren, insb das Verlangen nach Sonder- und Rahmenbetriebsplänen, kann nicht dazu führen, Anordnungen nach § 71 zu ersetzen.
Читать дальше