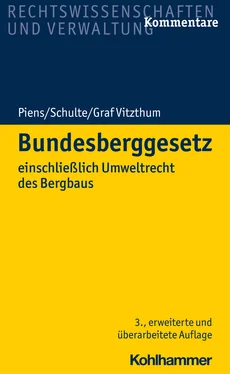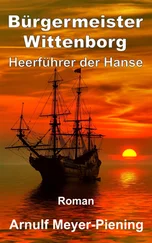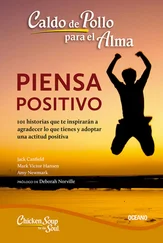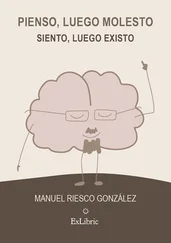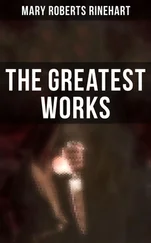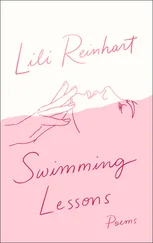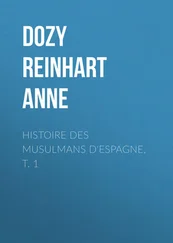2.Richtlinien Betriebsplanverfahren
48Welche Varianten die Sonderbetriebspläne inzwischen entwickelt haben, ergibt sich andeutungsweise aus Nr. 4 der Anl. 1 (Hauptbetriebsplan) der Richtliniendes früheren LOBA NRW über die Handhabung des Betriebsplanverfahrensv. 31.8.1999 (Az. 11.1-7-27, A7). Dort sind 49 Arten von Sonderbetriebsplänen aufgelistet. Welche Auswüchse das Sondertriebsplan(un)wesen inzwischen beherrschen, ergibt sich beispielhaft aus den sog. Gorleben-Urteil des BVerwG. Damals waren innerhalb von sieben Jahren „mehrere hundert Sonderbetriebspläne zugelassen und ausgeführt“ (ZfB 1995, 282), im Falle „Erdgasspeicher“ immerhin 45 nebst 10 Nachträgen (ZfB 1992, 39).
3.Sonderbetriebsplan „Bergehalden“
49 Sonderbetriebsplänewerden für das Anlegen, die Erweiterung und die wesentliche Änderung von Bergehaldenverlangt. Hierfür wurden Richtlinien entwickelt (in NRW der gemeinsame Runderlass betreffend Zulassung von Bergehalden im Bereich der Bergaufsicht v. 13.7.1984 – MinBl 931 = ZfB 1984, 366, im Saarland v. 2.1.1990, gem. MinBl Saarland, 21 = ZfB 1991, 228). In ihnen wird geregelt, welche Angaben und Nachweise der Sonderbetriebsplan enthalten muss, welche Behörden gem. § 54 Abs. 2 zu beteiligen sind (nach damaliger Organisationslage immerhin 15) oder als sachverständige Stellen anzuhören sind (damals 7) und welche Gesichtspunkte im Betriebsplanverfahren zu prüfen sind. Insb die Lagerstättenverhältnisse, Mehrkosten beim Versatz gegenüber Bruchbau, Größe und Höhe der Halde, ihre Eingliederung in die Umgebung und das Landschaftsbild, Einwirkungen der Halde auf Wasser, Boden, Luft und Klima sowie Auswirkungen auf den Naturhaushalt, Transportwege und -mittel, spätere Nutzung der Halde. Die Sicherung von Standorten für größere Halden (mehr als 2, 5 Mio. m³) erfolgt in Regionalplänen (früher Gebietsentwicklungsplänen), ihre Größe soll den Bedarf von etwa zehn Jahren decken. Sie sollen möglichst als landschaftsgerechte Landschaftsbauwerke gestaltet werden. Für die Errichtung der Halde ist außer der Zulassung des Sonderbetriebsplans eine wasserrechtliche Erlaubnis gem. §§ 8, 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG erforderlich, in der die Einwirkungen der Halde auf das Grundwasser geregelt und begrenzt werden. Werden die von der Halde abfließenden oder austretenden Wässer gesammelt oder in ein Gewässer eingeleitet, ist außerdem eine Erlaubnis nach §§ 8, 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG zu beantragen. Der Imissionsschutz für Halden betrifft Maßnahmen zur Einschränkung von Staubemissionen und von Lärmemissionen des Betriebes auf der Halde und durch die eingesetzten Maschinen, Geräte und Einrichtungen. Für das Verladen, Befördern und Abladen des Haldenmaterials im Kraftfahrzeugverkehrs auf öffentlichen Wegen können jedoch keine Imissionsschutz-Regelungen im „Sonderbetriebsplan Bergehalden“ getroffen werden (§ 2 Abs. 4 Nr. 2 BBergG; VG Gelsenkirchen, ZfB 1984, 243, ZfB1982, 96; VG Koblenz, ZfB 1984, 477).
50Die erforderliche Vorsorge zur Wiedernutzbarmachung der Haldenoberfläche wird ebenfalls in ihren Grundzügen vom Sonderbetriebsplan Bergehalden erfasst. Die Wiedernutzbarmachung als solche kann Gegenstand des Abschlussbetriebsplans oder von jährlichen weiteren Sonderbetriebsplänen „Wiedernutzbarmachung der Haldenoberfläche“ sein. Für Photovoltaikanlagen auf Bergehalden ist ein obligatorischer Rahmenbetriebsplan nicht erforderlich, s § 57c Rn 13, es genügt ein Abschluss- oder Sonderbetriebsplan. Zur Rekultivierung von Bergehalden: Neu/Hinterhölzel/Scherbeck/Hafenstein, Glückauf 2001, 568, zur Gestaltung der Oberfläche bei Berghalden: § 55 Rn 262.
50aSofern eine Halde einen Flächenbedarf von mehr als 10 ha hat, ist vorrangig ein UVP-Rahmenbetriebsplangemäß § 1 Nr. 3 UVP-V Bergbau erforderlich. Der Sonderbetriebsplan hat dann eine ergänzende Funktion. Halden können unter den Voraussetzungen des § 1 Nr. 1 Buchstabe a) aa) UVP-V Bergbau auch unabhängig von der Größe ihrer Grundfläche UVP-pflichtig ein, wenn sie Teil der übertägigen Betriebsanlagen eines Tiefbaubetriebes sind und die Betriebsflächen insgesamt einschl. der Halde 10 ha überschreitet. Auf die Größe der betrieblichen Teilfläche der Halde kommt es dann nicht an, sie teilt das Schicksal der gesamten Betriebsfläche (Keienburg, in: Boldt/Weller (2016), Anh. 57c Rn 32). Dasselbe gilt seit dem Jahr 2008 für Halden, die eine Abfallentsorgungseinrichtung der Kategorie A des Anhangs III der RL 2006/21 EG über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie (sog. Bergbauabfallrichtlinie) sind. Auch diese gefährlichen Halden sind grundsätzlich gemäß § 1 Nr. 4a UVP-V Bergbau UVP-pflichtig.
4.Sonderbetriebspläne „Abbaueinwirkungen“ und „Anhörung“
51Die bergrechtliche Praxis hat als Konsequenz aus dem sog. Moers-Kapellen-Urteil (BVerwG, ZfB 1989, 199 ff.) den Sonderbetriebsplan „Abbaueinwirkungen auf das Oberflächeneigentum“ (auch „Auswirkungen des Abbaus der Flöze XY auf die Tagesoberfläche“ VG Düsseldorf, ZfB 1992, 267, im Saarland „Anhörung der Oberflächeneigentümer“) entwickelt. Dieses Sonderbetriebsplanverfahren ist das „geeignete Verfahren“ im Sinne dieses Urteils, in dem Oberflächeneigentümern, die von schweren Bergschäden betroffen sein können, Gehör verschafft wird (OVG Saarland, ZfB 1993, 219 zur Zulässigkeit des Verfahrens; OVG Saarland, ZfB 1994, 22; ZfB 1996, 226; ZfB 1997, 47; ZfB 2005, 200; ZfB 2005, 220, die Letzteren allerdings nach Erledigungserklärung unwirksam gem. BVerwG, ZfB 2006, 155 f., ferner OVG NRW, ZfB 2003, 283; Knöchel, ZfB 1993, 133 und Bochumer Beiträge, 69 ff.; Knof Bochumer Beiträge, 55 ff.). Zusätzlich zur Beteiligung jedes einzelnen von der Bergbehörde ermittelten Oberflächeneigentümers, der von schweren Bergschäden betroffen sein könnte, wird der Sonderbetriebsplan öffentlich ausgelegt (Keienburg, NVwZ 2013, 1123, 1126).
52Der Zulassung eines Sonderbetriebsplans „Anhörung der Oberflächeneigentümer“ steht nicht entgegen, dass vorher ein obligatorischer Rahmenbetriebsplanmit UVP (OVG Saarland, ZfB 2005, 218, allerdings nach Erledigungserklärung unwirksam gem. BVerwG, ZfB 2006, 155) oder ein fakultativer Rahmenbetriebsplan zugelassen wurde (OVG Saarland, ZfB 1993, 218; Kühne/Ehricke, Entwicklungslinien des Bergrechts, 48). Es ist vom BBergG nicht vorgegeben, die Belange der Oberflächeneigentümer in einen bestimmten Typ der gesetzlich vorgegebenen Betriebsplanarten zu prüfen. Die Belange können im Rahmenbetriebsplan ausgeklammert und einem Sonderbetriebsplan vorbehalten werden (BVerwG, ZfB 2006, 319; OVG NRW, ZfB 2003, 278; Kühne, DVBl 2010, 875 m. w. N.; a. A. Niederstadt, NVWZ 2004, 1095). Das gilt für die Interessen von Grundstückseigentümern, die schwere Bergschäden befürchten müssen, ebenso wie für Auswirkungen des Bergbaus auf öffentliche Einrichtungen (Kanalisation, Ver- und Entsorgungsleitungen), die ebenfalls aufgrund detaillierter Abbauplanungen in Sonderbetriebsplänen geprüft werden (OVG NRW, ZfB 2003, 279; ZfB 2003, 284). Der Sonderbetriebsplan „Abbaueinwirkungen auf das Oberflächeneigentum“ ist abzugrenzen vom Rahmenbetriebsplan, der sich nach der Rspr. gerade nicht auf Eigentümerbelange bezieht (Frenz, NVwZ 2012, 1221, 1222). Allerdings ist der Sonderbetriebsplan „Abbaueinwirkungen“ in Beziehung zum Hauptbetriebsplanzu bringen. Für den Fall einer Änderung der Abbauführung infolge bergbaulicher Sachgesetzlichkeiten wird in der Praxis häufig im Hauptbetriebsplan eine Nebenbestimmung zur Vorlage des Sonderbetriebsplans „Abbaueinwirkungen“ aufgenommen, wodurch die Gestattungswirkung des Hauptbetriebsplans eingeschränkt wird. Wegen des verfassungsrechtlichen Gebotes der Prüfung von schweren und unerträglichen Abbaueinwirkungen auf das Grundeigentum wird man die Nebenbestimmung i. d. R. nicht als Auflage, sondern als Bedingung zum Hauptbetriebsplanansehen (Frenz, a. a. O., S. 1223). Diese Bedingung ist aufschiebend, wenn bereits bei Zulassung des Hauptbetriebsplans schwerwiegende Abbaueinwirkungen auf das Eigentum zu erwarten sind. Sie ist auflösend, wenn sie Vorsorge gegen schwerwiegende Einwirkungen durch zukünftige Abbauänderungen trifft (Frenz, a. a. O., 1223).
Читать дальше