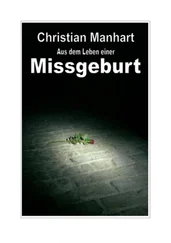Die harmlose Kreisstadt Pinneberg in Schleswig-Holstein war immer schon das liebste Spottobjekt der benachbarten Hamburger, obwohl keiner so richtig weiß, wie genau es dazu kam. Vielleicht liegt es am Autokennzeichen. Das PI auf dem Nummernschild steht aus Sicht der Großstädter für »Provinzidiot« oder vielleicht auch für »pennt immer«. Pinneberg gilt in Hamburg als Inbegriff der Langeweile und Hässlichkeit. Als Pinneberger muss man irgendwie mit diesem Stigma klarkommen. Man belügt sich selbst ein bisschen und tut so, als gehöre man zu den Weltstadtbewohnern. »In nur zwanzig Minuten bist du mit der S-Bahn mitten in der City«, war damals wie heute der Lieblingssatz eines Pinnebergers. Mit »City« ist dann natürlich nicht die kleine Pinneberger Fußgängerzone gemeint. Zur weiteren Stärkung des geschundenen Selbstbewusstseins sucht man sich als Pinneberger seinerseits gern Spottopfer. Früher fand man sie in den umliegenden Dörfern. Die Pinneberger definierten deren bäuerliche Bevölkerung als die eigentlichen Provinzidioten, die Prisdorfer zum Beispiel. Prisdorf ist das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin und das bis zum Abitur meine Heimat war.
Ich lebte in einem großen schmucken Bauernhaus mit einem riesigen Heuboden, mit Kuhstall, Schweinestall, Hühnerstall. Ein gutmütiger Collie, viele Katzen in allen Farben, ein großer Gemüsegarten und zwei Streuobstwiesen mit Bäumen zum Draufklettern, ein kleiner Fluss hinter dem Haus und saftige grüne Wiesen voller pastellfarbenem Wiesenschaumkraut und tiefgelben Sumpfdotterblumen. Das war in rosiger Rekonstruktion meiner Kindheitserinnerungen das norddeutsche Bullerbü. Ich war Lisa mit blonden geflochtenen Zöpfen. Wie sie hatte auch ich zwei Brüder. Nur waren sie viel älter als Lasse und Bosse bei Astrid Lindgren und mussten deshalb schon sehr viel auf dem Hof mitarbeiten. Aber ich war nicht nur die wohlbehütete, brave Lisa, ich war auch die eigensinnige, wilde Pippi, die viel allein spielte: In der Wildnis pflückte ich bunte Blumensträuße, baute ein Floß, saß in den Bäumen, kuschelte die Katzenbabys oder übte Saltos im Heu. Gegenüber wohnte Tommy, der im richtigen Leben Bernd hieß. Er war so alt wie ich, hatte blonde strubbelige Haare und Sommersprossen. Beide waren wir nicht im Kindergarten und verbrachten sehr viel Zeit miteinander. Gemeinsam badeten wir als Nackedeis in der Kuhtränke auf der Hausweide, heirateten heimlich im Kuhstall mit zwei der roten Plastikringe, die die Hühner am Bein trugen. Manchmal haben Bernd und ich uns geprügelt. Ich war stärker und konnte kratzen wie eine Katze. Das tat weh und Bernd lief dann weinend nach Hause zu seiner Mutter. Wir haben unsere Wunden geleckt, schnell alles vergessen und uns noch am selben Tag wieder vertragen.
Die beste Zeit war der Sommer. Dann war unser großer Gemüsegarten ein üppiges Paradies. Alles, was reif war, erntete ich und stopfte die farbenfrohe Beute direkt in meinen Mund: Himbeeren, Stachelbeeren, Erbsen, junge Karotten und Radieschen und natürlich die Erdbeeren. Manchmal musste ich beim Strohfahren, beim Kühehüten, Kälbertränken oder bei der Milchkontrolle ein bisschen mithelfen.
Meine beiden Brüder waren vierzehn und sechszehn Jahre älter. Mit mir hatte keiner mehr gerechnet. Ich war nicht geplant und für mich gab es keine Pläne. Später würde der ältere meiner Brüder sagen: »Wir wurden noch erzogen, aber Dörte wurde verzogen«, und würde damit meinen, dass ich sehr viel Freiheit und kaum Grenzen erfahren habe. Ich würde später sagen: »Ich habe mich selbst erzogen«, und würde damit meinen, dass die Erwachsenen zu beschäftigt waren, um sich um mich zu kümmern.
In unserem Haus waren die beiden Weltkriege noch nicht lange her. Einige Fenster in den alten Holztüren hatten einen Sprung. Das war passiert, als die benachbarte Bahnstrecke bombardiert wurde. In den großen dunklen Eichenschränken und Truhen, in denen ich an langen Wintertagen so gern wühlte, fanden sich Uniformen, Säbel und Orden. Auch im Kopf meines Vaters und besonders im Kopf meiner Großmutter schien der Krieg noch ganz nah zu sein.
Als meine Mutter mit mir schwanger war, hoffte sie auf ein Mädchen. Meine Großmutter glaubte nicht daran und sagte: »Mädchen wachsen auf diesem Hof wohl nicht.«
Sie war schon mit Anfang zwanzig Mutter von drei Söhnen und Witwe. Ihr Mann kam aus dem ersten Weltkrieg nicht zurück. Auf dem Rückweg von der Krim bekam er die Spanische Grippe. »Ernst, wir kommen doch jetzt nach Haus«, hatte ein Kamerad ihn ermutigen wollen und er antwortete: »Ihr kommt alle nach Haus, aber ich nicht mehr.«
Er wurde in Griechenland bei Saloniki begraben und musste seine junge Frau mit den Kindern und dem großen neuen Hof allein lassen.
Die drei Söhne mussten in der Landwirtschaft früh sehr hart arbeiten. Obwohl er fast noch ein Kind war, musste auch der jüngste Sohn, der später mein Vater werden sollte, den schweren Ackergaul oft allein anschirren. Einmal schlug der bockige Gaul heftig aus und traf meinen Vater in den Bauch. Aus Angst vor den Kosten wurde kein Arzt gerufen. Ein Nachbar brachte den schwer verletzten Jungen schließlich im letzten Moment noch ins Krankenhaus. Es war allerhöchste Zeit: Er wäre fast innerlich verblutet. In einer langen Notoperation wurde ihm die Milz entfernt und sein Bauch wieder zusammengeflickt.
Der zweite Weltkrieg nahm meiner Großmutter dann zwei ihrer Söhne. Ihr ältester Sohn, der den Hof hätte übernehmen sollen, kam aus Russland nicht zurück. Ihr mittlerer Sohn, der als einer der ersten aus dem Dorf in Hamburg Abitur gemacht hatte, war ein Offizier der Luftwaffe. Er wurde mit seiner Propellermaschine abgeschossen. Nur mein Vater musste wegen der Folgen seiner Operation nicht in den Krieg ziehen. Er war der Einzige, der meiner Großmutter blieb. Sie sagte später bei schlimmen Ereignissen immer: »Wer weiß, wozu das noch gut ist.«
Meine Brüder bekamen die Namen ihrer gefallenen Onkel, deren gerahmte Fotos in Schwarz-Weiß über dem Sofa meiner Großmutter hingen. Ich bekam nicht so einen gebrauchten altmodischen Namen wie meine Geschwister. Meine Brüder wählten »Dörte« für mich aus. Sie fanden den Namen damals total schick und modern. Sie konnten nicht wissen, dass keine Mädchen außerhalb von Norddeutschland und auch dort keine, die nach 1970 geboren wurden, so heißen würden.
In der Grundschule lernte ich Mädchen kennen und spielte immer weniger mit Bernd. Meine neuen Freundinnen waren die Töchter der Zugezogenen. Sie lebten mit ihren Familien in Einfamilienhäusern in den Neubaugebieten. Sie hatten Zentralheizung, große Fenster ohne Gardinen und Möbel aus hellem Holz. In ihren Wohnzimmern standen offene Bücherwände und Stereoanlagen. Viele hatten Partykeller mit Tresen und Barhockern und im Garten hatten manche sogar einen Swimmingpool. Meine Freundinnen hatten Väter, die morgens im Anzug zur Arbeit fuhren und abends wiederkamen. Sie hatten Mütter mit Kurzhaarfrisuren, die mit dem Auto zum Supermarkt fuhren, Tennis spielten und in modernen Einbauküchen lange Spaghetti kochten oder Artischocken zubereiteten.
In den Ferien fuhren meine Freundinnen mit ihren Eltern mit dem Wohnwagen nach Frankreich, mit der Segelyacht nach Schweden oder flogen mit dem Flugzeug nach Spanien. Als mir mein Bullerbü langsam zu klein erschien, fing ich an, die anderen um ihre Ferienabenteuer in den fernen Ländern zu beneiden. Dass die anderen mich wegen des Heubodens, der Kletterbäume und der Katzenbabys beneideten, war mir nur ein schwacher Trost.
Immer öfter sagte ich zu Hause Sätze, die mit »Die anderen haben auch alle …« anfingen, und meine Mutter antwortete mir dann immer in ihrer einfühlsamen, warmherzigen Art: »Das mag sein, aber wir sind nicht die anderen.«
Sie hatte verdammt recht. »Leider«, fand ich. Trotzdem hatte ich mit den Kindern der anderen eine sehr gute Zeit. Annette, Anke, Steffi, Berrit, Kirstin und ich liefen Nachmittage lang Schlittschuh, bauten Verstecke im Wald und verkleideten uns oft. Wir turnten, tanzten, spielten Handball und Tennis im TSV Prisdorf. Am besten war es mit Annette. In einer Osternacht standen wir um Mitternacht auf, gingen stumm zu einer Quelle, um uns dort zu waschen. Das würde ewige Schönheit bringen, hatten wir irgendwo über diesen aufwendigen Osterbrauch gelesen. Wir fanden nur den Graben neben den Bahngleisen, wuschen uns trotzdem und waren sicher, dass wir nun immer schön sein würden. In den Wiesen der Pinnau-Niederung suchten wir nach Fröschen, um sie zu küssen. Keiner verwandelte sich in einen Prinzen. Das machte aber nichts, denn es gab ja noch unzählige ungeküsste Frösche und sicher würden wir irgendwann den richtigen Frosch finden.
Читать дальше