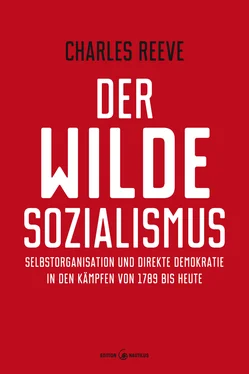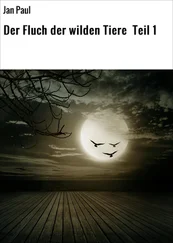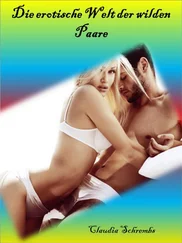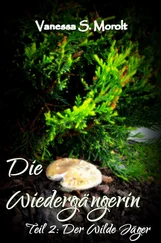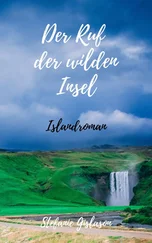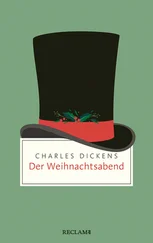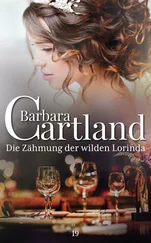Die babouvistische Strömung wird häufig als unversöhnlicher Gegner des Privateigentums und Vertreter eines Kommunismus in der Verteilung dargestellt. Ihr Programm schließt allerdings eher an die Forderungen an, die die Enragés – oftmals unorganisiert und individuell – dem Nationalkonvent vorgelegt hatten: Erfassung und Beschlagnahmung von Grundnahrungsmitteln, Kampf gegen die Wucherer und Spekulanten, Verstaatlichung des Handels, Terror gegen die Klassen des Ancien Régime, uneingeschränkte Ausübung der Souveränität und der direkten Demokratie sowie Frauenrechte. Die Babouvisten betraten nach der Unterdrückung der Radikalen durch die Jakobiner und nach dem Thermidor die Bühne der Revolution. Sie organisierten sich als unabhängige und abgeschirmte, ja klandestine Strömung. Zitieren wir nochmals Kropotkin, der ihre politischen Vorstellungen in den Gesamtverlauf der Revolution einordnet. Er attestiert Babeuf eine »enge« Auffassung des Kommunismus, die Gestalt annahm, als die Reaktion des Thermidor der aufsteigenden Bewegung der Großen Revolution ein Ende bereitet hatte: »Die Idee, durch die Verschwörung, vermittels einer geheimen Gesellschaft, die sich der Macht bemächtigen sollte, zum Kommunismus zu gelangen […] ist ein Produkt der Erschöpfung – nicht eine Wirkung des aufsteigenden Saftes der Jahre 1789 bis 1793.« 42Babeufs »Aktionsmittel […] brachten die Ideen des Kommunismus auf ein niedrigeres Niveau herunter. Während viele Geister der Zeit einsahen, daß eine Bewegung in der Richtung des Kommunismus das einzige Mittel war, die Errungenschaften der Demokratie zu sichern«. 43Tatsächlich kennzeichnete das politische Projekt der babouvistischen »Gleichen« ein erheblicher Widerspruch, der den Beschränkungen der Epoche geschuldet war. Während sie klar aufzeigten, warum das repräsentative System des Parlamentarismus falsch war und die formelle Gleichheit eine Täuschung bleiben musste, solange es keine wirtschaftliche gab, sahen sich die Babouvisten als eine elitäre Führung, die imstande war, »zum Wohle des Volkes« von oben eine neue Form von Repräsentation durchzusetzen, gestützt auf die Sektionen, Klubs und Volksversammlungen, die sie »Versammlungen der Souveränität« nannten. Ihr Organisationsmodell beruhte insofern gerade auf der Aufgabe der Forderung nach Souveränität und direkter Demokratie: Der Aufstand sollte das Werk der Verschwörung einer kleinen bewussten Minderheit sein, bei dem die Führer sicherstellen, dass die Souveränität des Volkes respektiert wird – eine ausgesprochen dirigistische Vorstellung. Wie Babeufs Gefährte Philippe Buonarroti später erläuterte, sollte ein »Aufstandskomitee die Grundlagen zur sozialen Einteilung« legen, um »die Gleichheit aufrechtzuerhalten«; es sollte »die Dinge so […] leiten, daß das Prinzip der Volkssouveränität niemals verletzt werde«, dass dem Volk »keinerlei Verpflichtung […] ohne seine wirkliche Einwilligung« auferlegt werden könne und »es in seinen Beratungen alle wünschenswerte Reife« mitbringe. 44
Das Unternehmen erforderte somit eine provisorische revolutionäre Diktatur, um die Volkssouveränität zu erweitern und »die wahre Demokratie« der zukünftigen kommunistischen Gesellschaft aufzubauen – eine widersprüchliche Konstruktion, in der sich spätere totalitäre Modelle andeuteten. Für die Babouvisten hing die direkte Demokratie zwar unmittelbar mit der Verwirklichung wirtschaftlicher Gleichheit zusammen, beides war aber dem verschwörerischen Handeln einer entschlossenen revolutionären Elite untergeordnet. Das sozialistisch-jakobinische Denken der nachrevolutionären Zeit konnte dieses Projekt mühelos integrieren, und wie gezeigt worden ist, weisen die Vorstellungen von Blanqui, Barbès und später der Ersten Internationale eine direkte Verwandtschaft mit denen von Babeuf und Buonarroti auf. 45Der Form, nicht aber dem Inhalt nach verändert, kehrt diese dirigistische Konzeption später auch in der Staatstheorie der Sozialdemokratie und ihrer radikalen Spielart, des Bolschewismus, wieder. Die Basisorgane sozialer Bewegungen, die Räte oder Sowjets, blieben für solche Strömungen eine »souveräne Ausnahme«, eine Kraft, die die Partei der Wissenden für das Ziel instrumentalisieren konnte, den für den Aufbau des Sozialismus notwendigen Staatsapparat zu übernehmen und umzumodeln.
Im Kern war dies ein jakobinisch-avantgardistisches Programm, das eine »Verkoppelung der ›Verfassung von 1793‹ mit den ökonomischen und sozialen Forderungen der Arbeiterklasse« vornahm, wie Korsch 1929 notierte. Nach dieser für die weitere Entwicklung der sozialistischen Bewegung prägenden Konzeption setzt der auf der sozioökonomischen Ebene angesiedelte Kommunismus zunächst die Einführung einer »radikalen Demokratie« jakobinischen Typs voraus – den revolutionären Staat. 46Das Führungsorgan des Aufstands muss die Form der Avantgardepartei annehmen, der revolutionäre Staat einheitlich, zentralisiert, also antiföderalistisch organisiert sein.
KAPITEL 2
DIE PARISER KOMMUNE (1871)
DIE GRENZEN EINER PRAXIS DER »REINEN DEMOKRATIE«
FALLSTRICKE DES GEGENSATZES VON ZENTRALISMUS UND FÖDERALISMUS
Der Widerspruch zwischen zentralistischen und föderalistischen Vorstellungen von Politik und Gesellschaft war älter als die Französische Revolution und die Konzeption der Jakobiner. Bereits die Aristokratie hatte in ihrem Kampf gegen den Feudalismus auch eine autoritär-zentralistische Strömung umfasst. Von der Französischen Revolution bis ins frühe 20. Jahrhundert setzte sich das jakobinische Modell dann in der bürgerlichen Politik durch und prägte mehr oder minder deutlich auch sozialistische Strömungen, angefangen bei bestimmten Utopisten über die Anhänger Blanquis bis zu marxistischen Bewegungen. Das zentralistische Staatsmodell und die Ablehnung von Föderalismus verbanden sich zudem mit dem parlamentarisch-repräsentativen System. Permanente Abtretung von Souveränität versus direkte Demokratie, Staat versus Selbstregierung, Zentralismus versus Föderalismus – all dies waren in den Debatten der sozialistischen Bewegung zentrale Themen.
Dabei vertrat Proudhon dezentrale Konzeptionen von Wirtschaft und politischer Organisation, die dem jakobinischen Zentralismus zuwiderliefen: Dem vom Zentralstaat oktroyierten »Gesellschaftsvertrag« hielt er ein föderalistisches Modell entgegen. Jakobinisch geprägte Strömungen setzten dies häufig mit einer Rückkehr in die Vergangenheit gleich – eine einseitige, irreführende Behauptung, denn der föderalistische Gedanke ermöglichte es Proudhon zugleich, eine neue Form der Ausbeutung zu kritisieren. Im Gegensatz zwischen Staatseinheit und Föderalismus erkannten Denker wie Proudhon und Edgar Quinet, dass die Revolution » als Kampf um die Zerstörung des alten Zwanges und die Verwirklichung einer neuen Freiheit mit unvermeidlicher geschichtlicher Notwendigkeit zugleich einen neuen Zwang und eine neue Unfreiheit in sich selbst hervorbringt «. 1
Der Dissens zwischen Marx und Proudhon betraf vor allem wirtschaftliche Fragen. Verstärkt wurde er durch die politischen Positionen, die der französische Philosoph nach 1848 vertrat, sowie durch die unklare Haltung seiner Anhänger zur Regierung von Napoléon III. Marx befasste sich während seiner aktiven Zeit in Deutschland, im Jahr 1848 sowie ab 1864 in der Ersten Internationale nur sehr wenig mit der Frage von Zentralismus und Föderalismus an sich. Für Proudhon ergab sich das Konzept eines föderal-dezentralisierten politischen Aufbaus aus seinem ökonomischen Entwurf einer Gesellschaft, die er sich als Assoziation von Privatproduzenten vorstellte. Was Marx mit ihm teilte, war ein »Widerwille gegen die sozialistische Gefühlsduselei« und die Ablehnung utopischer Sozialisten. 2Aber Marx hatte ein Verständnis von politischer Macht, das dem einheitlich-zentralistischen Staat die Schlüsselrolle bei der Veränderung der Gesellschaft und der Abschaffung der Ausbeutung zuwies, und er kritisierte Proudhons Projekt als einen Versuch, »den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit« einzuebnen; darauf ziele sein »ganzes Banksystem, sein ganzer Produktentausch«. 3Für Marx stand dies einem Bruch mit dem System der kapitalistischen Ausbeutung entgegen, aus dem die soziale Emanzipation hervorgehen sollte.
Читать дальше