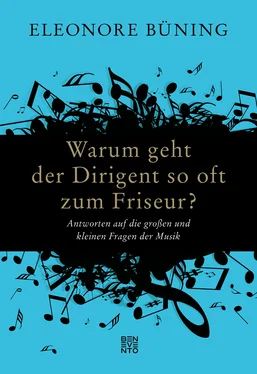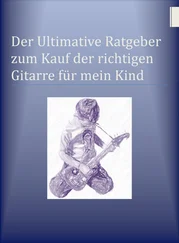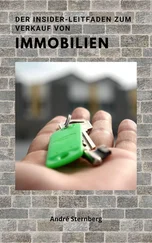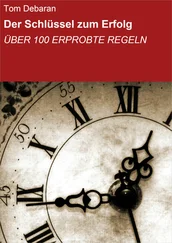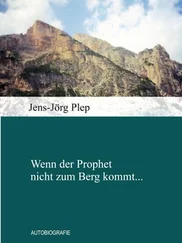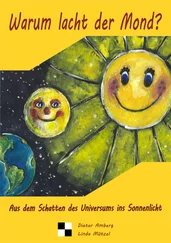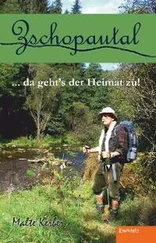Dieses Opernaktfinale ist musikalisch überwältigend und zugleich »ekelhaft« (Reich-Rancki). Diesen Widerspruch müssen wir aushalten. Die sogenannte Prügelfuge ist keine Fuge, bloß ein im Chaos versumpfendes Fugato. Auch lässt sich Beckmessers krauses Ständchen, welches dafür das Kopfthema liefert, nicht als Karikatur von Synagogengesängen erklären. Mit den chromatisch-melismatischen Sprechgesängen der Klezmerklarinette aus dem Schtetl, Filmmusikfarbe vom Dienst in den Holocaust-Dokus, hat diese diatonische, auf Quarten fußende Melodie erst recht nichts zu tun. Nein, Anatevka ist nicht das politisch korrekte Gegengift zu den Meistersingern, Herr Kosky! Aber davon ein andermal.
23. Juli 2017
10
Warum muss ein Wagner die Wagnerfestspiele leiten?
Erstens, weil die Mitglieder der Familie Wagner andernfalls auf Dauer arbeitslos wären. Das kann, ökonomisch und sozial, niemand verantworten. Sie haben nichts anderes gelernt. Sie können nur Festspiele leiten oder unglücklich sein. Richard Wagners verzweigte Nachkommenschaft ist ja schon seit Generationen nachhaltig traumatisiert durch die Tatsache, dass es kein Kreativitäts-Gen gibt. Dieser großartige Komponist hat zwar alle möglichen körperlichen und charakterlichen Merkmale sehr schön weitervererbt, darunter etwa die Liebe zum Hund (alle Wagners haben Hunde). Aber er gab nicht den kleinsten Funken Genie weiter. Bereits Karl Kraus bemerkte zu den dreizehn Opern, die Siegfried Wagner schrieb: »Nie erbt doch so ein Kerl das Talent, und immer die Nase.« Immerhin, der Sohn hatte es noch versucht! Die Enkel und Urenkel studierten dann Hauswirtschaft oder Fotografie oder Theaterwissenschaft und warfen einander anschließend Inkompetenz vor. Dass sie um ihr Unglück wissen, beweisen die alljährlich ab Mai, Juni aufflammenden Familienzerwürfnisse, deren Anlässe austauschbar sind. Mal geht es um ein angeblich übertätowiertes Hakenkreuz, mal um eine angeblich verschlossene Schublade in München, mal um ein angebliches Hügelverbot. In Wahrheit geht es immer um die Sinnlosigkeit des Daseins.
Zweitens wäre es juristisch natürlich denkbar, dass die Wagners eines Tages aus ihrem Albtraum erlöst werden könnten. Schon seit Gründung der gemeinnützigen Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth im Mai 1973 kann sich grundsätzlich jeder um die künstlerische Leitung der Richard-Wagner-Festspiele bewerben. Laut § 8,2 der Stiftungsurkunde geht der Zuschlag an ein oder mehrere Mitglieder der Familie Wagner nur dann, wenn nicht »andere, besser geeignete Bewerber auftreten«. Wie Letzteres zu evaluieren ist, wurde nicht festgelegt. Die Latte liegt niedrig. Bewerber sollten die acht Hauptwerke Richard Wagners kennen und bereit sein, sechzig Tage im Jahr hart zu arbeiten, davon einen Tag am roten Teppich. Praktische Theatererfahrung und Kenntnisse im Regieführen, Kostümbilden, Buchhalten, Notenlesen, Singen, Klavierspielen, Dirigieren oder Telefonieren können zwar ebenso nützlich sein wie ein Führerschein Klasse drei oder ein goldenes Reitabzeichen, sind aber nicht zwingend notwendig. Es gibt historische Präzedenzfälle, Festspielleiter aus dem Familienkreis wie Cosima oder Winifred, die etliche dieser Qualifikationen nicht mitbrachten und trotzdem erfolgreiche Festspiele organisiert haben.
Der Pool von Festspielleiterkandidaten ist also, satzungsgemäß, erfreulich groß, sehr viel größer als in der öffentlichen Diskussion zurzeit bewusst. Fast alle vier- undzwanzigtausend Mitglieder der Richard-Wagner-Vereine kämen infrage, ideal zumal die älteren, die sämtliche Ring-Inszenierungen in und außerhalb Bayreuths seit Chéreau auf dem Schirm haben und alle Wagnerwerke auswendig zitieren und mitsingen können. Zum Beispiel: die vielbewunderte Margot Müller, Autohändlerin, Unternehmerin, Vorsitzende des Richard-Wagner-Verbands Würzburg, 93. *Sie sitzt im Kuratorium der Festspiele, sie kennt sich aus, hat einen Horizont, der über Wagners Welt weit hinausreicht, und ein großes Herz. Regelmäßig veranstaltet Müller mit ihrem Bus »Loge« kommentierte Opernreisen, beispielsweise zur Arena von Verona oder nach Stuttgart, zu Tschaikowskys Dornröschen. Warum hat sie sich nie um die Festspielleitung beworben? Siehe oben, Punkt 1.
14. Juni 2015
*Postskriptum: Inzwischen ist Margot Müller verstorben. Als Motto eines ihrer letzten Rundbriefe zitierte sie warnend Franz Schubert: »Wer die Musik liebt, kann nie ganz unglücklich werden.«
11
Warum geht der Dirigent so oft zum Friseur?
Tut er das? Ich persönlich habe dort noch nie einen angetroffen. Zweitens: Mit Musik hat diese Frage nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Insofern, wegen nachweisbarer Unzuständigkeit, hatte ich die Frage, als sie das erste Mal gestellt wurde, sofort und spontan, allerdings glücklos, weiterreichen wollen an einen Kolumnistenkollegen, der sich mit Haaren oder vielmehr dem Problem ihrer Abwesenheit eventuell ein bisschen besser auskennt. Seltsamerweise tauchte sie seither immer wieder auf, hartnäckig und in vielerlei Gestalt.
Ganz ernsthaft, zum Beispiel, gestellt von Denis Scheck, vor knapp einem Jahr; dann, im Januar, von einer guten alten Hamburger Freundin, als wir friedlich in der Elbphilharmonie beisammensaßen und zusahen, wie fesch Maestro Kent Nagano wieder herein eilte, mit federndem Schritt und frisch geföhnter, wehender Indianerhäuptlingsmähne. Zuletzt, das gab den Ausschlag, kam es dazu vorvorgestern in Salzburg, wo aus Jubiläumsgründen zurzeit überall der markenzeichenhafte Schopf von Osterfestspielgründer Herbert von Karajan ins Auge fällt: im Prinzip ein klassischer Bürstenhaarschnitt mit Elvis-Tollen-Anmutung, zum Zeichen ewiger Jugend; nur ohne Pomade und interessant ergraut, mit weißen Strähnen darin, zum Zeichen reifer Autorität; schließlich etwa zwei Zentimeter länger, als Elvis selbst diese Frisur trug, was ein Kämmen der sturmwindmäßig fixierten Pracht mit fünf oder zehn Fingern erlaubt.
Karajan ist, auch in puncto Frisur, eindeutig ein Prototyp gewesen. Anfang der Dreißigerjahre, als Generalmusikdirektor in Ulm, trug er seine Bürste noch kurz. Das war vermutlich praktischer für einen ehrgeizigen, jungen Workaholic. Doch hätte Karajan mit einer so billigen Allerweltsfrisur jemals den rundum genial verstrubbelten, in der Mitte indes halbkahlen Wilhelm Furtwängler aus dem Felde schlagen und die Berliner Philharmoniker übernehmen können? Sicher nicht.
Friseur und Dirigent haben viel gemeinsam. Sie sind, wenn sie gut sind, ungeheuer gefragt: Figaro hier, Figaro dort. Sie sind, nicht alle, aber doch die allermeisten, klein von Statur und eine Führernatur mit Napoleon-Komplex. Und üben beide einen Dienstleistungsberuf aus, der auch individuelle künstlerische Spielräume impliziert, müssen auch beide in Ausübung ihres Berufs stundenlang stehen, während ihre Kundschaft sitzen darf. Im Unterschied zum Friseur wendet der Dirigent dabei den Kunden konsequent seinen Rücken zu, ja, er ist der einzige Entertainer, der sich dem Publikum nur kurz und ausnahmsweise von vorn zeigen kann, nämlich dann, wenn die Vorstellung vorbei ist oder noch nicht begonnen hat.
Dazu kommt das leidige Genderproblem. Sie können ja nichts dafür; doch Dirigenten sind bis heute, immer noch und in überwiegender Mehrzahl, männlichen Geschlechts, und jeder Mann, wirklich ein jeder, auch jeder Dirigent, trägt seine Achillesferse am Hinterkopf, dort, wo es kahl wird. Bei fast allen. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Das ist das Dirigententrauma: der Hinterkopf. Deshalb braucht jeder Dirigent einen guten Friseur.
Einige tragen sicherheitshalber luftig plüschige Dauerwelle, andere tun lässig so, als sei ihnen ihr Rückspiegel total egal. Wieder andere, etwa Thomas Hengelbrock, untersagen jedwede Veröffentlichung von Fotos, die sie von hinten zeigen. Sie bilden sich ein, vogelstraußartig, damit seien sie partiell quasi unsichtbar. Andere, die mit den napoleonischen Geheimratsecken, etwa Leopold Stokowski, haben sich grundsätzlich nur in linker Seitenansicht fotografieren lassen. Stokowski glaubte, er sähe von links besser aus. Glenn Gould beschreibt das so treffend, weil er Stokowski durchschaute. Auch Pianisten, üblicherweise dem Publikum rechtsseitig zugewandt, kennen Problemzonen.
Читать дальше