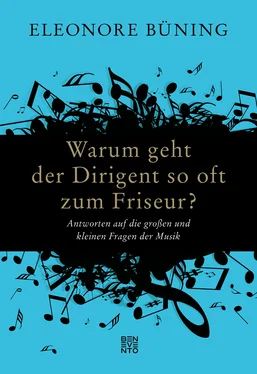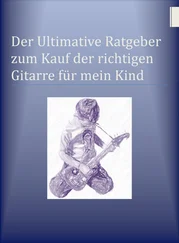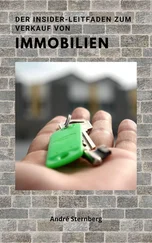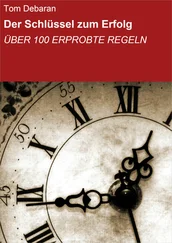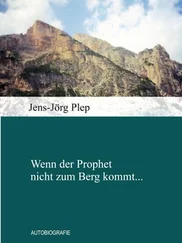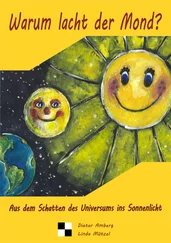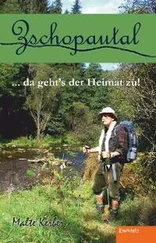Kochs Musikalisches Lexicon von 1807 unterscheidet noch ein Dutzend Möglichkeiten, wo und wie Fermaten angewendet werden sollten. Aber bereits 1832 möchte sich Johann H. Göroldt in seinem Handbuch der Musik, des Generalbasses und der Composition zum Selbstunterricht, Kapitel 16, § 6, nicht mehr festlegen. Er schreibt: »Wie lang man eine Fermate machen soll, lässt sich nicht genau bestimmen, dieß hängt von der Beschaffenheit und dem Charakter des Stücks, so wie auch von dem Gefühle des Componisten ab, und von dem Geschmacke des Spielers.« Auch Dommers Musikalisches Lexicon von 1865 beruft sich beim Stichwort »Fermate« auf Gefühl und Wellenschlag: »Verschiedene Ursachen können den Tonsetzer zu solcher Unterbrechung des Flusses der Taktbewegung veranlassen. Der Ausdruck der Verwunderung, des Erstaunens, eine plötzliche Hemmung des Gefühlsstromes, überhaupt Empfindungen, deren Bewegung selbst einen kurzen Stillstand zu machen scheint oder die gleichsam durch völlige Ergießung momentan sich erschöpft haben …«
Merkwürdige Koinzidenz: Als die Musiktheoretiker damit begannen, die Fermate in die Freiheit zu entlassen, war die Kadenz gerade von den Komponisten festgezurrt worden. Mozart und Beethoven hatten noch selbst am Flügel gesessen und, von der Fermate an, frei improvisiert. Mozart schrieb dann, um Eitelkeiten anderer zu unterbinden, zu einigen seiner Klavierkonzerte die Kadenzen auf. Beethoven schon zu allen.
Freilich, auch in Bach-Chorälen kommen Fermaten vor. Auch etliche alte Kirchengesangbücher notieren Fermaten, schließlich, die Gemeinde schleppt, jeder Laiensänger möchte am Ende der Verszeile ordentlich Luft holen. Der Dirigent Nikolaus Harnoncourt liebte es, auch Profisängern in Bach-Chorälen eine romantische Auszeit zum Einatmen zu gewähren. Der junge Harnoncourt war nämlich einmal Zeuge gewesen, wie der Münchner »Bach-Richter« (gemeint ist Karl Richter) im Wiener Musikverein bei der Aufführung der Matthäus-Passion auf einem erhöht postierten Neupert-Cembalo (»besonders scheußlicher Klang«) bei den Fermaten, ganz wie ein eitler Solopianist, ohne den Chor weiterzufahren pflegte; sein »Sortiment der Kadenzfloskeln« sei »unerschöpflich« gewesen, schreibt Harnoncourt, es reichte »vom Eintonschluß bis zur Tausendfüsslerkadenz«.
Kurzum: Frei ist die Fermate geboren, frei zu sein ihre Bestimmung. Im Ranking der bekanntesten Haltestellen der Musikgeschichte stehen zweifellos die drei Fermaten vom Anfang der Mozartschen Zauberflöten-Ouvertüre ganz oben. Ich nehme an, die meisten Pianisten würden eher die Fermate ganz am Ende der Es-Dur-Fuge kurz vor der letzten Beethovenschen Diabelli-Variation auf den ersten Platz wählen: Poco adagio. Ausgenommen Igor Levit. Seine Lieblingsfermate ist die vor dem Präludium zum Benedictus aus der Missa Solemnis.
10. Februar 2019
5
Warum müssen sich Musiker verbeugen?
Müssten sie nicht. Nicht mehr. Rockmusiker, zum Beispiel, haben sich das längst abgewöhnt. Sie winken, reißen die Arme hoch in Siegerpose oder hüpfen glücklich herum. Schlagersänger werfen Kusshändchen oder lispeln, was genauso idiotisch ist, ein »Dankeschön« ins Mikro, kaum dass der letzte Playbackton verklungen ist. Nur die klassischen Musiker, die Theaterschauspieler, die Judokas und einige wenige Oberkellner alter Schule befolgen noch immer die Etikette des Wiener Hofzeremoniells. Sie machen einen Diener, beugen den Rücken, gehen in die Knie. Verkehrte Welt. Ist nicht die Kunst der wahre Souverän, seit mehr als zweihundert Jahren?
Bekannt ist das spätestens seit dem Juli 1812. Da gingen Goethe und Beethoven auf der Kurpromenade in Teplitz miteinander spazieren, wo ihnen unverhofft die kaiserliche Familie entgegenkam. Herr von Goethe machte den Weg frei, in tiefer Verbeugung. Herr van Beethoven behielt den Hut auf dem Kopf. Er soll sogar schnurstracks weiter geradeaus gelaufen sein, mitten durch die Hofgesellschaft hindurch, und sich später über Goethes serviles Verhalten mokiert haben. Zwar verdanken wir den einzigen Bericht über diesen Vorfall Bettine von Arnim. Sie war nicht dabei. Es könnte also auch ganz anders oder gar nicht passiert sein. Doch dass Bettine, dieses geniale Groupie, eine begnadete Märchenerzählerin und Briefe-Fälscherin, es manchmal doch mit der höheren Wahrheit hielt, zeigt ein echter, nicht von ihr gefälschter Brief Beethovens, gerichtet an den Verleger Härtel, des Wortlauts: »Göthe behagt die Hofluft zu sehr mehr als es einem Dichter ziemt, Es ist nicht vielmehr über die lächerlichkeiten der Virtuosen hier zu reden, wenn Dichter, die als die ersten Lehrer der Nation angesehn seyn sollten, über diesem schimmer alles andere vergessen können.«
Das Sich-Verbeugen ist eine archaische Geste der Unterwerfung. Nicht nur der Mensch, auch andere räuberische Säugetiere, die in Rudeln leben, werfen sich freiwillig in den Staub und zeigen Bauch oder Rücken, zum Zeichen dessen, dass sie sich dem Stärkeren unterordnen. Vor Alexander dem Großen legten sich Bittsteller der Länge nach hin. Vor dem Kaiser von China machten sie dreimal einen Buckel. Der Kotau wurde 1912 abgeschafft, Kratzfuß und Hofknicks vor Zar oder Kaiser 1918, und selbst Queen Elizabeth II, Höchstplatzierte in der Rangfolge der britischen Royals, besteht heute nicht mehr darauf, dass Gatte oder Sohn vor ihr einknicken. Bei niederen Chargen genügt ein leichtes Neigen des Kopfes. Es ist ein unerklärliches Phänomen, warum ausgerechnet im Theater, im Opernhaus und im Konzertsaal die sogenannte »spanische Reverenz« des Ancien Régime immer noch weiterleben konnte, umbenannt in »Applausordnung« – als ein erstarrtes oder vielmehr verkümmertes Ritual, das eigens vor jeder Premiere neu geprobt werden muss, und zwar passend zum Stück: Wer darf als Erster buckeln oder hofknicksen vor dem Publikum, wer als Letzter?
Wer kommt von rechts aus der Gasse, wer von links? Wann fasst man einander an den Händen und verbeugt sich als Chorus-Line? Wie lange darf Kammersängerin X an der Rampe im Knicks versinken, wann muss die Primadonna ausschwärmen, um den Dirigenten zu holen, wann die Seconda Donna den Regisseur? Und so weiter. Kommt einer zu früh oder zu spät, bringt das Unglück. Das Einstudieren dieser hierarchisch sortierten, von Aberglauben umwitterten Verbeugungsparade ist in der Regel Sache des Regieassistenten. Er kann dabei viel falsch machen.
Dabei ist dieses ganze verflixte Ritual selbst eine Fälschung und seine Abschaffung überfällig. Sicher, wir nehmen es hin als Teil der Vorstellung, eine Art Buffo-Nachspiel zur Tragödie, finita la commedia . Wir haben uns gewöhnt an diese ulkigen Auftritte voller Pannen, wie wir uns auch an den Kummerbund des Dirigenten und die Lakaienuniform der Orchesterspieler gewöhnt haben. Es soll sogar immer noch klassische Musiker geben, die sich, wie Goethe, darauf berufen, dass gewachsene Rituale im Umgang miteinander das Leben erleichtern. Doch auch die werden ihre Meinung ändern an dem Tag, an dem das Publikum schweigend aufsteht und sich vor ihnen verneigt.
3. Februar 2020
Weil es zu warm ist. Kann aber auch sein, es ist zu trocken oder zu kalt oder zu windig, zu hell, zu dunkel oder es liegt sonst was in der Luft. Waldhörner sind wie Pferde: äußerlich stark und glänzend, innerlich zerbrechliche Seelchen, leicht zu verunsichern und außerdem allzu reich mit der Gabe der Empathie gesegnet. Manchmal wirft ein Pferd seinen Reiter nur ab, weil der gerade an ein verunglücktes Meeting denkt. Manchmal kiekst das Horn, weil der Hornist sich tags zuvor unglücklich verliebt hat. Oder weil der Dirigent seine Blicke zufällig gerade in ihrer beider Richtung hat schweifen lassen. Allein das reicht schon aus, schwupps, hat sich der Ton verschoben und sitzt nicht mehr da, wo er eben gerade noch gesessen hatte in dieser bis zu vier Meter langen, schneckenförmig aufgewickelten Metallröhre und wo er ganz bestimmt innert der nächsten zwei Zehntelsekunden wieder sitzen wird. Nur: jetzt nicht. Verpasst, verpeilt, versagt. Der Solohornist hat sein Solo verkiekst, und das hat nun wirklich jeder mitgekriegt, selbst der harthörigste Mensch im Saal.
Читать дальше