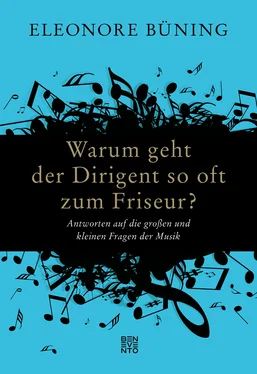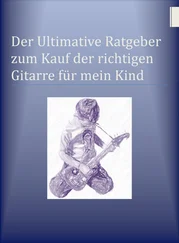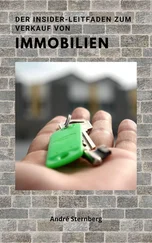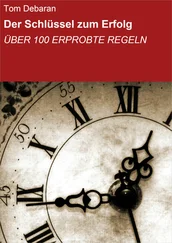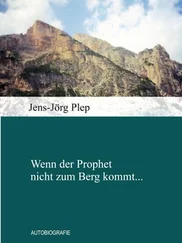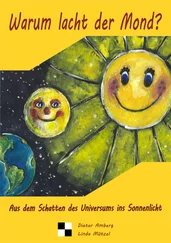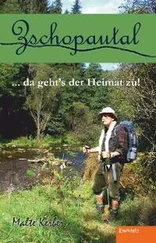Die Harfe harft, die Orgel orgelt, die Bratsche bratscht, die Zither zithert und so weiter. Viele Musikinstrumente haben lautmalerische Namen. Nicht nur Ukulele, Didgeridoo, Kazoo oder Balalaika, auch Bongo, Gong, Kontrabass, Trommel oder Posaune. Beethoven fiel zum Klavier – alias Hammerflügel alias Fortepiano alias Pianoforte, einem Instrument, das sich seinerzeit so rasch und grundstürzend weiterentwickelte, dass man den Überblick verlieren konnte – eines Tages der schöne Name »Starkschwachtastenkasten« ein. Hätte auch von Oskar Pastior sein können. Oder von Kurt Schwitters. All das erklärt sich von selbst. Im Wunderreich der Lautpoesie gibt es aber auch Rätsel, die keine Erklärung haben. Wir hören den Namen, wissen auf Anhieb, wie das Ding klingt, aber nicht, was es ist. Zum Beispiel: der Bluntschli.
Der erste Bluntschli wurde vom Dichterkomponisten Georg Kreisler anno 1958 entdeckt. Er fand ihn in der Schachtel des Herrn Wachtel neben »a Birne und a Knopf«, außerdem lag da noch ein blauer Bleistiftspitzer. Wie Kreisler gleich erkennt, ist der Bluntschli, anders als die liebliche, stupsnäsige Ukulele, kein Götter-, vielmehr ein Danaergeschenk. Der Bluntschli ist »gefährlich, beschwerlich, entbehrlich«, er klingt gollumartig dunkel, glitschig, tückisch. Kann sein, der Bluntschli ist, wie Birne oder Knopf, jenseits des Klanglichen auch noch zu irgendetwas nützlich. Aber dann wird das wohl etwas Unheilvolles sein, vielleicht sogar, wie Jandls »schtzngrmm« und eingedenk O. W. Fischers etwas Weltkriegsartiges. Es ist also besser, nicht weiter nachzufragen. Was der Bluntschli ist, weiß bis heute kein Mensch. Gut so.
22. Oktober 2017
3
Sollte man im Regen singen?
Ja, unbedingt. Machen Sie das. Fangen Sie bei nächster Gelegenheit damit an. Jeder von uns kennt den guten alten Brauch des Singens in der Badewanne. Viele praktizieren ihn, andere singen wahlweise morgens unter der Dusche. Aber immer noch wagen es nur wenige Menschen, draußen im Regen zu singen, obwohl Singen nachweislich glücklich macht und das nasse Element stimulierend wirken kann auf die Stimmbänder, ganz unabhängig von der musikalischen Begabung dessen, der sich ihm aussetzt.
Begünstigt wird diese falsche Zurückhaltung offenbar auch durch eine gewisse Trägheit des Herzens der Filmschaffenden. Zum Thema Regen fällt ihnen nicht viel ein. Seit die Bilder laufen lernten, regnet es im Kino bei fast allen Beerdigungsszenen. Nasse Hosenbeine und schwarze Regenschirme sind die wohlfeilste, dümmste, aber leider auch häufigste Requisite für Tränen und Trauer, und es spricht Bände, dass Gene Kelly, als er 1953 gegen diesen, pardon, Strom schwamm, noch nicht einmal nominiert wurde für einen Oscar. Dabei steht Singin’ in the Rain bis heute ganz oben auf der Liste der besten Filmsongs aller Zeiten.
Jede Menge Regenschirme, aber nicht den Schatten einer Beerdigung zeigte Joris Ivens in seinem epochemachenden Dokumentarfilm Regen, den er 1928 in Amsterdam drehte. Das Klischee ist außer Kraft. Ein Stummfilm. Niemand singt. Menschen kommen nur stark angeschnitten und am Rande vor, man sieht sie aus der Vogelperspektive oder aber nur Beine und Füße, keine Gesichter, weder lachende noch weinende.
Trotzdem hat ein so scharfsinniger Komponist wie Hanns Eisler, der die Dummheit in der Musik aufspießte, wo immer er sie antraf, Jahre später, als er, ausgestattet mit einem Stipendium der Rockefeller-Stiftung, nachträglich eine Filmmusik zu diesem Ivens-Film schrieb, die alte Chiffre der Trauer wieder aufgegriffen. Die meisten seiner Vierzehn Arten, den Regen zu beschreiben für Streichtrio, Flöte, Klarinette und Klavier wirken zwar eher burlesk als triste. Natürlich tropft was ab und zu, es spritzt und plätschert, in traditioneller Tonmalerei. Eisler selbst aber erklärte, das Stück sei »gleichbedeutend mit vierzehn Arten, mit Anstand traurig zu sein«. Während er im November 1941 im Exil in Hollywood daran komponierte, marschierten gerade deutsche Truppen in die Sowjetunion ein. So steht also am Anfang der zwölftönigen Komposition programmatisch ein Anagramm, als eindeutiges und starkes Signal: eine achttaktig auskomponierte Lamentofigur, unter Verwendung der Tonbuchstaben A, Es, C, H – der Initialen Arnold Schönbergs, dem das Stück übrigens gewidmet ist.
Wassermusiken, lustige und traurige, politische und sentimentale, gibt es, seit es Musik gibt. Ungezählt die musikalischen Niederschlagsmengen von Händel über Beethoven und Chopin bis Eric Clapton. Jeder Tropfen macht Musik, viele Tropfen machen manchmal auch einfach nur Krach, und je nachdem wie viel Wasser herunterkommt, kann das teuer werden.
Etwa fünfzigtausend Euro gingen den Bach hinunter bei den diesjährigen Opernfestspielen in Heidenheim, als Nabucco ersatzlos ausfiel wegen eines plötzlichen Sommergewitters. Kurz zuvor gab es in Tanglewood, Massachusetts, mitten im ersten Akt der Bohème einen so phantastischen Wolkenbruch, dass eine Viertelstunde lang gar nichts mehr zu hören war vom Liebesjubel der kleinen Mimì. Immerhin, wir drinnen in dem offenen Landschaftskonzertsaal »The Shed« hatten, wie auch die Musiker, ein Dach überm Kopf und viel Spaß. Evakuiert wurden nur die feinen Leute mit den Picknickkörben auf den Wiesen drumherum. Anders bei den Bregenzer Festspielen: Hier spielt das Orchester sowieso sicherheitshalber im Saal. Der Sound wird übertragen. Aber draußen auf der Tribüne, bei der Carmen-Premiere voriges Jahr, sind alle hundsjammervoll nass geworden, eimerweise schüttete es von oben, hoch türmten sich die Wellen, grell zuckten die Blitze im Sekundenabstand, um die triefenden Sängerinnen und Sänger herum, die auf der Seebühne eisern weitersangen.
Abbruch? Unmöglich! Man ist hier erst ab der dritten Vorstellung gegen das Wetter versichert, hieß es. Die Policen für Premieren sollen einfach unbezahlbar sein. Es war aber eine Riesengaudi, ehrlich. Unvergesslich, diese Carmen. Lange hat die Habanera noch in uns nachgedieselt, als wir alle längst wieder trocken waren. Singen im Regen macht einfach glücklich. Man muss nicht einmal selber singen.
22. Juli 2018
4
Wie lang darf eine Fermate sein?
Solange der Atem reicht. Hoffentlich noch die halbe Ewigkeit. Kann aber auch mit einem Wimpernschlag vorbei sein. Früher gab es verbindliche Regeln. Unsereins hat im Musikunterricht noch Merksprüche auswendig lernen müssen wie: »Der Punkt verlängert die Note um die Hälfte ihres Wertes« oder: »Die Fermate verdoppelt den Notenwert«. Heutzutage, lieber Leser, ist Ihre Frage schon fast philosophischer Natur, jeder Musiker, jede Musikerin darf sie sich selbst beantworten, von Fall zu Fall.
Für alle Nichtmusikerinnen und Nichtmusiker: Eine Fermate ist eine Art Haltestelle (von italienisch »fermare« für »anhalten«). In älteren musiktheoretischen Schriften wird sie auch Corona (»Kranz««, »Krone«) oder point d’orgue (»Orgelpunkt«) genannt. Das Zeichen dafür sieht aus wie ein umgedrehter Smiley mit nur einem Auge. Es kann über einer Note, einer Pause, über einem Taktstrich oder einfach nur am Anfang oder Ende einer Musik stehen, also praktisch überall. Wer dieses Signal erreicht hat, der muss aussteigen und pausieren. Manchmal erwischt es alle, dann handelt es sich um eine Generalpause. Steht der einäugige Smiley in einem Solistenkonzert über einem Quartsextakkord, steigt nur das Orchester aus und der Solist fährt allein weiter. Man nennt dies auch »Kadenz« (zu Deutsch Fall, fallend). Anders als in einem Gedicht gibt es in einem Konzert aber keine weiblichen oder männlichen Kadenzen. Stattdessen: Dominantseptakkorde. Findet der Solist nach einem Weilchen zu einem solchen, darf das Orchester wieder mit einsteigen. Wie lange dauert das Weilchen? Tja. Genau das ist die Frage.
Читать дальше